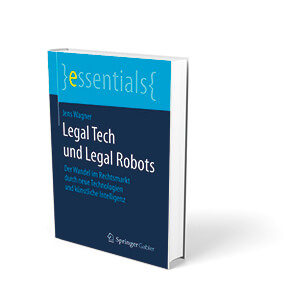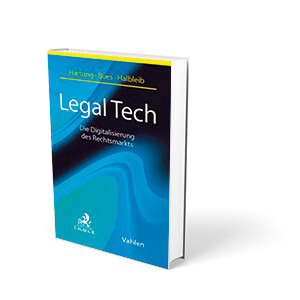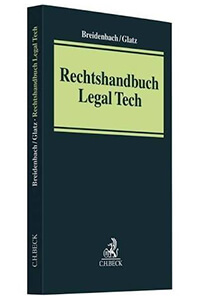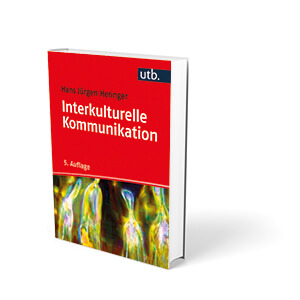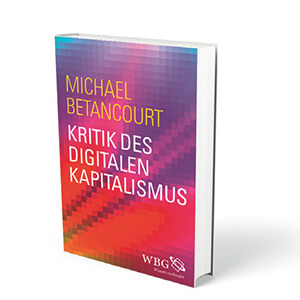Rechtsberatung durch Chatbots? Juristisch denkende Maschinen, die Vertrauen bilden? Rechtsfindung mit Hilfe künstlicher Intelligenz? Was für Traditionalisten undenkbar erscheint, ist für Legal Tech-Pioniere die juristische Arbeitswelt von morgen. Der große Vorteil der digitalen Transformation: Nie war das Recht effizienter. Und selbst die hochwertige und individuelle Beratung wird durch Innovationen gesichert. Weil dafür nun endlich die Zeit da ist. Von André Boße
Effizienz – kaum ein anderes Wort beschäftigt die internen Kontrollorgane in den Kanzleien aber auch Rechtsabteilungen so sehr wie dieses. Lange galt die juristische Arbeit als reinstes People Business: Beratung bedeutete Qualität, die hatte ihren Preis. Ideen wie Standardisierungen oder Automatisierungen spielten kaum eine Rolle – und wenn, dann in den unteren Bereichen der juristischen Arbeit, dort, wo wirklich Routine-Jobs erledigt werden. Doch die Stimmung hat sich geändert, parallel zum Bedarf nach höherer Effizient nimmt der Begriff Legal Tech an Bedeutung zu: Den immer besseren digitalen Methoden gelingt es, weitere Arbeitsprozesse von Anwälten oder Unternehmensjuristen zu standardisieren oder sogar zu automatisieren.
Geht nicht? Gibt’s nicht mehr. Schon heute krempelt Legal Tech die Arbeitsstrukturen in vielen Kanzleien oder Rechtsabteilungen um. Tendenz steigend. Das heißt natürlich nicht, dass die juristische Arbeit überflüssig wird. Im Gegenteil, eine gute anwaltliche Beratung ist gerade für Mandanten aus der Wirtschaft immer wichtiger in dieser globalen, komplexen und sich rasend schnell verändernden Welt. Wer aber qualitativ und preislich mithalten will, der muss seinen Mandanten oder Arbeitgebern eine Arbeitsweise bieten, die neue digitale Innovationen nicht als überflüssig oder sinnlos vorverurteilt, sondern aufnimmt.
Von Rechtsabteilungen wird Innovation verlangt
Zunächst ein Blick in die Unternehmen selbst, wo auch die Rechtsabteilungen unter dem Einfluss des Wandels von Wirtschaft und Organisation stehen. „Rechtsabteilungen werden viel früher und intensiver in die Innovationsprozesse eingebunden, die Hälfte der Rechtsabteilungen hierzulande sogar häufig bis sehr häufig“, lautet das Ergebnis der Studie „Legal Management of Innovation“ des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ) sowie der Wirtschaftskanzlei CMS. Bislang waren Juristen in Unternehmen nicht unbedingt als betriebseigene Innovatoren bekannt. Doch das ändere sich gerade, stellt die Studie fest:
Smart Contracts
Smart Contract sind Computerprotokolle, die Verträge darstellen, prüfen sowie die Verhandlung und Abwicklung unterstützen. Durch diese intelligente Vertragssoftware, die einen gedruckten Vertrag überflüssig machen kann, bieten sich im Vertragsrecht viele neue Möglichkeiten. „Wir haben noch gar nicht damit angefangen, die rechtlichen Fragen zu beantworten, die durch sie aufgeworfen werden“, sagt der Legal Tech-Experte Jochen Brandhoff. Genau diese Diskussion bietet das von Brandhoff initiierte Online-Rechtsmagazin „The Legal ®evolutionary“ – zu finden im Netz unter:
legal-revolution.com/de/the-legal-revolutionary.
„Die Befragungen haben gezeigt, dass die Rechtsabteilungen durch stärkere Spezialisierung und Standardisierung von Prozessen mittels Legal Tech wesentlich zum Innovationserfolg beitragen können“, sagt Dr. Jörg Zätsch, CMS-Partner und Co-Autor der Studie. „Proaktives und lösungsorientiertes Engagement und schnelle Reaktionszeiten gelten dabei als Schlüssel zum Erfolg.“
Ob durch die frühzeitige Entwicklung von Musterverträgen oder die Entwicklung bereichsübergreifender Prozesse zur Effizienzsteigerung: An Möglichkeiten, als Rechtsabteilung durch Innovationen positiv wahrgenommen zu werden, fehle es nicht. Mehr denn je seien daher die Rechtsabteilungen gefordert, neu zu denken: Ein Unternehmen, das sich im Zuge der digitalen Transformation neu aufstellt, tut das in allen Bereichen – da stehen auch die Unternehmensjuristen unter Zugzwang.
Legal Tech in der Großkanzlei
Für die großen Wirtschaftskanzleien werden Innovationen im Bereich Legal Tech zu einem echten Markenkern. Ein juristischer Berater, der ein Unternehmen auf die Chancen und Herausforderungen einer digitalen Transformation vorbereiten will, muss diese Aspekte zwingend auch intern auf dem Schirm haben, das verlangt erstens die Glaubwürdigkeit, zweitens aber auch der Marktdruck: Der Bedarf an anwaltlicher Beratung in den Unternehmen steigt, der Wettbewerb aber auch, gerade mit Blick auf die Preise.
Die Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz mit Hauptsitz in Düsseldorf zählt zu den Sozietäten, die Legal Tech-Innovationen bereits in vielen Bereichen einsetzt. „In der Mandatsarbeit kommt Legal Tech bei uns vor allem in großen, oft komplexen Compliance- und Kartellverfahren zum Einsatz“, sagt Dr. Alexander Schwarz, Co-Managing Partner. „Daneben in Transaktionen – insbesondere im Real Estate-Bereich – sowie in zunehmender Weise auch in Massenverfahren.“ Darüber hinaus nutze die Kanzlei eine Reihe von Tools bei der allgemeinen Mandatsarbeit, beispielsweise beim Erstellen von umfangreichen Vertragswerken oder dem Führen von elektronischen Verzeichnissen.
„Wir haben dabei eine Reihe von digitalen Helfern entwickelt, die das Arbeitsleben spürbar effizienter machen“, sagt Schwarz. „Insgesamt sind wir hier bereits weit fortgeschritten und haben die Mandatsbearbeitung nahezu vollständig digitalisiert.“
Erforschung von KI
Wissenschaftler unterschiedlichster Forschungseinrichtungen haben in der Studie „The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation“ Szenarien entwickelt, in denen die bösartige Nutzung der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens aufgezeigt werden. Ziel der Studie ist es nicht, gegen die technische Entwicklung zu arbeiten, doch es soll darauf hingewiesen und dafür sensibilisiert werden, dass der technische Fortschritt nicht nur für gute Zwecke genutzt werden kann. Weitere Infos unter: www.eff.org/files/2018/02/20/malicious_ai_report_final.pdf
Einen Widerspruch zwischen der Automatisierung verschiedener Bereiche und dem Versprechen vieler Kanzleien nach individueller und exzellenter Beratung sieht der Co-Managing Partner von Gleiss Lutz nicht, im Gegenteil: „Je mehr wir repetitive Aufgaben durch Software unterstützen oder ersetzen können, desto mehr schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Anwälte Freiraum für individuelle und persönliche Beratung haben.“ Hier führe die Effizienz also auch zu mehr Qualität.
Null-Toleranz bei der Sicherheit
Ein bedeutsamer Punkt bei der Digitalisierung juristischer Prozesse ist die Datensicherheit: Hacks und Leaks wären für eine Kanzlei oder die Gerichte der Super-Gau, weshalb laut Alexander Schwarz von Gleiss Lutz das Thema Cybersecurity als große Herausforderung wahrgenommen wird: „Es besteht eine Null-Toleranz-Linie: Wir setzen keine Software ein, wenn sicherheitsrelevante Zweifel bestehen.“ Die Software müsse leicht in die komplexe IT-Landschaft integrierbar sein, den sehr hohen IT-Sicherheitsanforderungen entsprechen und gesetzliche sowie datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllen – nur solche Produkte kämen überhaupt in Frage. Aber wie weit wird die Automatisierung gehen?
Alexander Schwarz glaubt an zwei Entwicklungen: „Der Technologieeinsatz in der Mandatsarbeit wird weiter zunehmen. Die Rechtsberatung an sich ist und bleibt jedoch ein People Business.“ Wobei dies insbesondere für hochkomplexe Mandate gelte, in denen die großen Wirtschaftskanzleien wie Gleiss Lutz tätig sind.
Juristen müssen an die Preise denken
Im Fokus von Legal Tech-Lösungen stehen daher zunächst leichter standardisierbare juristische Arbeiten – vor allem solche, die andere auch bieten, mitunter zu einem geringeren Preis. „Anwälte sind teuer“, sagt Jochen Brandhoff, Gründer und Partner der Kanzlei Brandhoff Obermüller Partner in Frankfurt am Main sowie Veranstalter der Kongressmesse „Legal ®Evolution“, die sich Entwicklungen der digitalen Transformation des Rechts widmet. Bei außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen gelte das besonders, aber auch die Vertretung vor Gericht koste zu viel, meint der Jurist: „Viele hochwertige Dienstleistungen – nehmen wir nur die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer – sind zu einem besseren Preis-Leistungs- Verhältnis zu haben.“
Das Problem am Preis sei nun nicht, dass die Arbeit der Juristen diesen nicht wert sei. Aber: „Juristen könnten viel effizienter arbeiten.“ Ein zentraler Bereich für Effizienzsteigerungen sei die Organisation: Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen könnten viel Geld, Zeit und Nerven sparen, indem sie wichtige Geschäftsprozesse definieren und digitalisieren. „Ein Kernprozess für Juristen ist die Erstellung rechtlicher Dokumente, zum Beispiel von Vertragsentwürfen und Klageschriften“, erklärt Brandhoff. „Kanzleien und Rechtsabteilungen können diesen Prozess digitalisieren und automatisieren, zum Beispiel mit einer Software wie Lawlift.“ Ein weiteres Beispiel sei der Prozess für das Mandatsmanagement: Komplexe Mandate könnten durch digitales Projektmanagement schneller, mandantenfreundlicher und mit weniger Aufwand bearbeitet werden.
Chatbots und Blockchain
Wandeln werde sich aber auch die Königsdisziplin des Anwaltberufs: die hochwertige und vertrauensvolle juristische Beratung. Klar, das Gespräch zwischen Anwalt und Mandant bleibt wichtig. „Aber die persönliche Beratung ist nicht immer Voraussetzung für eine hochwertige Rechtsberatung“, glaubt Jochen Brandhoff. Das zeigten immer häufiger Legal Chatbots – also maschinelle Kommunikationspartner. Der Legal Tech-Experte ist sich sicher: „Die digitale Transformation des Rechts kann die Kommunikation zwischen Rechtssuchenden und Rechtsdienstleistern verbessern – ohne menschliches Zutun.
Schon bei der Blockchain-Technik haben wir gesehen, dass nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen Vertrauen aufbauen können: Blockchains sind so sicher, dass sie das in der Wirtschaft unentbehrliche Vertrauen in das Funktionieren des Marktes selbst aufbauen, es muss nicht mehr von Notaren oder Banken vermittelt werden.“ Hier punktet Technik gegen den Faktor Mensch – ein Phänomen, das, glauben Experten, man auch bei den autonom fahrenden Autos erleben wird, die sicherer unterwegs sein sollen als der fehleranfällige menschliche Fahrer.
Der Legal Tech-Experte Brandhoff prognostiziert daher, dass der Rechtsmarkt in 15 Jahren ganz anders aussehen wird als heute. „Disruptiv wird vor allem die Automatisierung rechtlicher Arbeit wirken. Algorithmen und die darauf beruhende Software werden Juristen in immer mehr Bereichen nicht nur unterstützen, sondern ersetzen – immer häufiger auch bei komplexen Rechtsdienstleistungen.“
Das reiche bis zum Kern der juristischen Arbeit, nämlich der Rechtsanwendungen selbst, von der Prüfung eines Anspruchs bis zur Erstellung eines Vertrages. „Die automatisierte Rechtsfindung wird durch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglicht, die noch vor drei Jahren undenkbar waren.“ Spätestens dann ist die Revolution da. Und zu den Gewinnern zählt, wer sich früh mit den Chancen der digitalen juristischen Transformation vertraut macht.
Buchtipp:
Legal Tech und legal Robots
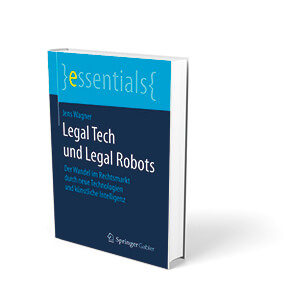 Dieses Buch beschreibt und systematisiert die Einsatzbereiche von Legal Tech, einschließlich künstlicher Intelligenz, erörtert die Auswirkungen auf Kanzleien und Rechtsabteilungen und zeigt die damit einhergehenden strategischen sowie rechtlichen Implikationen auf. Der Autor, Dr. Jens Wagner, ist Rechtsanwalt in München, er geht sowohl auf die theoretischen Möglichkeiten als auch auf aktuelle Anwendungsbeispiele aus der Praxis ein. Jens Wagner: Legal Tech und Legal Robots. Springer Gabler 2018. (Amazon-Werbelink)
Legal Tech-Literatur
Dieses Buch beschreibt und systematisiert die Einsatzbereiche von Legal Tech, einschließlich künstlicher Intelligenz, erörtert die Auswirkungen auf Kanzleien und Rechtsabteilungen und zeigt die damit einhergehenden strategischen sowie rechtlichen Implikationen auf. Der Autor, Dr. Jens Wagner, ist Rechtsanwalt in München, er geht sowohl auf die theoretischen Möglichkeiten als auch auf aktuelle Anwendungsbeispiele aus der Praxis ein. Jens Wagner: Legal Tech und Legal Robots. Springer Gabler 2018. (Amazon-Werbelink)
Legal Tech-Literatur
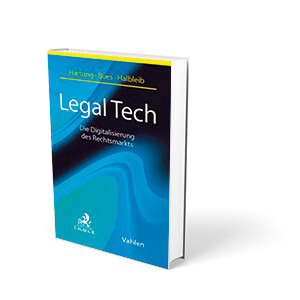 Tief ins Detail des Legal Tech-Themas geht das von Markus Hartung, Dr. Micha-Manuel Bues und Dr. Gernot Halbleib herausgegebene Buch „Legal Tech. Die Digitalisierung des Rechtsmarkts“. Das Fachbuch gibt einen facettenreichen Überblick über den Einsatz von Legal Tech in Kanzleien und Rechtsabteilungen und formuliert Strategien für eine erfolgreiche Digitalisierung. Mit konkreten Anwendungsbeispielen und Erfahrungsberichten erläutern namhafte internationale Experten, wie und in welchem Umfang Legal Tech die Arbeit in Kanzleien und Rechtsabteilungen verändert. Markus Hartung, Micha-Manuel Bues, Gernot Halbleib: Legal Tech. C.H.Beck 2018. (Amazon-Werbelink)
Tief ins Detail des Legal Tech-Themas geht das von Markus Hartung, Dr. Micha-Manuel Bues und Dr. Gernot Halbleib herausgegebene Buch „Legal Tech. Die Digitalisierung des Rechtsmarkts“. Das Fachbuch gibt einen facettenreichen Überblick über den Einsatz von Legal Tech in Kanzleien und Rechtsabteilungen und formuliert Strategien für eine erfolgreiche Digitalisierung. Mit konkreten Anwendungsbeispielen und Erfahrungsberichten erläutern namhafte internationale Experten, wie und in welchem Umfang Legal Tech die Arbeit in Kanzleien und Rechtsabteilungen verändert. Markus Hartung, Micha-Manuel Bues, Gernot Halbleib: Legal Tech. C.H.Beck 2018. (Amazon-Werbelink)