Experimente, die im Computer simuliert werden, Big-Data-Analysen, die Patientenbiografien als verästelte Bäume darstellen, neue Entwicklungen, die das Leben im Alter vereinfachen: Die Bezüge zwischen Forschung und neuer Technik werden immer direkter. Dabei ändert sich auch die Arbeit selbst. Forschung 4.0 nutzt die Digitalisierung, um sich konzentriert Menschen und Märkten zu widmen. Von André Boße
Alles wird digital. Und doch steht der Mensch im Mittelpunkt. Ein Widerspruch? Nicht, wenn es nach den Autoren einer neuen Studie über wirtschaftlichen Erfolg in der Life-Science-Branche geht. Erarbeitet wurde sie vor der Unternehmensberatung KPMG, das zentrale Ergebnis: „Life Sciences-Unternehmen rücken den Patienten zunehmend in den Fokus ihres Handelns. Dazu benötigen sie eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie.“
Was das bedeutet, zeigt folgendes, von den Autoren der Studie entworfenes Szenario auf. In Zukunft werde es möglich sein, die Spur einer Krankheit zu lesen. Dies funktioniert mit Daten über zum Beispiel genetische Besonderheiten, erbliche Krankheiten, andere Behandlungen mit eventuellen Nebenwirkungen. So entstehe ein „Healthcare-Baum“, der ganz ähnlich aussehen könnte wie der Stammbaum einer Familie. Dieser Baum werde durch jeweils neu erhobene Daten ständig weiterwachsen, neue Äste kommen hinzu, andere differenzieren sich immer weiter aus. „Ein sicherer Austausch dieser Daten unter den beteiligten Medizinern, Therapeuten und Pharmazeuten wird nicht nur dazu führen, dass Healthcare personalisiert wird. Die Daten begleiten die Forscher bei der Entwicklung neuer Präparate“, heißt es in der KPMG-Studie von Ende 2017.
Pharma glaubt, dass IT das Geschäft antreibt
Die Autoren sind sich sicher: Die Abbildung von Patientenbiografien in Form des sich stetig wandelnden Baums werden dazu führen, dass sich die gesamte Wertschöpfungskette in den forschungsintensiven Healthcare-Branchen ändern wird. Und die Unternehmen glauben das auch: 85 Prozent der befragten Akteure der Gesundheitsindustrie haben schon jetzt erkannt, dass die digitale Transformation die Rollen und Abläufe der Brache verändern wird.
Zudem interessant, gerade für Forscher: Ebenfalls 85 Prozent der Unternehmen glauben, dass Akteure aus der IT-Branche die treibenden Kräfte des Wandels sein werden; immerhin 63 Prozent der Unternehmen aus der Healthcare-Branche können sich vorstellen, schon innerhalb eines Jahres enge Kooperationen mit diesen ITUnternehmen einzugehen. Diese Werte zeigen, dass sich auch die Forschung und Entwicklung künftig in die digitalen Prozesse integrieren werden. Absolventen der Naturwissenschaften sind in den Unternehmen mit ihrer Arbeit dieser neuen digitalen Wertschöpfung nicht mehr vorgeschaltet – sie sind ein bedeutsamer Teil dieser Abläufe.
Life-Science-Unternehmen: wo die Reise hingeht
In welche Richtung sich Life-Sciences- Unternehmen entwickeln, steht im Mittelpunkt der Studie „Digitalization in life sciences – Integrating the patient pathway into the technology ecosystem“ von KPMG. In Zusammenarbeit mit Kantar EMNID wurden 75 Geschäftsführer, Inhaber, Vorstandsvorsitzende und Abteilungsleiter aus der Life-Sciences- Branche in der DACH-Region hinsichtlich ihrer Fortschritte bei der Digitalisierung befragt. Die Studie zeigt innovative Anwendungsfälle und gibt Einblicke in die Unternehmenspraxis.
https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2017/12/digitalization-in-lifesciences.html
Big Data: Nutzung muss dringend ausgebaut werden
Aber welche IT-Techniken sind für die Forschung relevant – und wie werden sie eingesetzt? Fragt man Klaus Mueller nach dem wichtigsten Digi-Trend, lässt die Antwort nicht lange auf sich warten: „Big Data – also die Analyse großer Datenmengen.“ Mueller ist Geschäftsführer der Digitalagentur TWT Digital Health mit Sitz in Heidelberg, dort ist er Experte für Digital Health. Einer der Motoren für neue Geschäfte sei das Marketing: „Data-Driven“, werde dieses in Zukunft sein, sagt er. „Viele Pharmaunternehmen entwickeln aktuell Multi Channel-Konzepte. Ziel ist es, die Zielgruppen über verschiedene Kanäle wie Website, Social Media, Apotheke oder Außendienst zu erreichen und die Ansprachen in den Kanälen aufeinander abzustimmen.“ Noch bedeutsamer werde in seinen Augen jedoch eine Technologie, die aus den „Analysen von Big Data Rückschlüsse und Erkenntnisse zieht, die man auf den ersten Blick nicht erkennt“. Es gehe also nicht nur darum, effizienter zu arbeiten, das Ziel sei es tatsächlich, einen Mehrwert zu schaffen. Wobei Mueller auch sagt, dass die Pharmaindustrie in diesem Bereich noch Nachholbedarf hat: „Bei der Nutzung großer Datenmengen aus neuen Technologien oder bestehenden Datenquellen steht die Branche noch ganz am Anfang.“
Real-Word-Daten und Ambient Assisted Living
An der Menge der verfügbaren Daten liege das nicht: Die Unternehmen besitzen riesige Mengen an Studiendaten. „Jedoch sind diese nur von beschränkter Aussagekraft“, sagt Mueller. „Denn so uniform wie das Kollektiv der Studienteilnehmer mit einem Dutzend Ein- und Ausschlusskriterien ist ein Patientenkollektiv im richtigen Leben leider nie. Viele Patienten erhalten viele verschiedene Medikamente verschrieben, und kaufen auch noch das eine oder andere Präparat.“ Diese Vielfalt könne man in klinischen Studien nicht abbilden – wohl aber mithilfe von Real-World-Daten (kurz: RWD) also Gesundheitsdaten, die unter realen Alltagsbedingungen erhoben werden und damit für die IT eine „klassische Big Data-Anwendung sind“, wie Klaus Mueller sagt.
Ein weiterer bedeutsamer Trend ist für ihn das Gebiet des „Ambient Assisted Living“ (AAL): Durch die stetig ansteigende Lebenserwartung der in Deutschland lebenden Menschen ist absehbar, dass die deutsche Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten zunehmend älter wird. Zudem bleiben ältere Menschen immer länger geistig und körperlich fit und stellen höhere Ansprüche an ihren Lebensabend. Helfen sollen hier technische Systeme, die zunehmend in der Lage sind Alltagstätigkeiten zu erleichtern oder zu übernehmen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fasst diese unter „Ambient Assisted Living“ zusammen:
Chemie: Investitionen in digitale Transformation
Laut der Studie „Chemie 4.0“ des Verbands der chemischen Industrie (VCI) planen die Unternehmen der Branche in den kommenden drei bis fünf Jahren milliardenschwere Ausgaben, um Digitalisierungsprojekte und neue digitale Geschäftsmodelle zu stemmen. „Indem wir künftig digitale Massendaten nutzen, kann unsere Branche ihre Rolle in den Wertschöpfungsketten erweitern und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Darüber hinaus verfügen wir über zukunftsorientierte Lösungen, um die zirkuläre Wirtschaft voranzutreiben“, beschreibt VCI-Präsident und BASF-Vorstandsvorsitzender Kurt Bock das Potenzial von Chemie 4.0 für die Entwicklung der Unternehmen.
https://www.vci.de/presse/pressemitteilungen/chemie-4-punkt-0-innovationen-fuer-eine-welt-im-umbruchstudie-von-deloitte-und-vci.jsp
„Das steht für Konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die neue Technologien in den Alltag einführen, um die Lebensqualität für Menschen in allen Lebensphasen, vor allem im Alter, zu erhöhen“, heißt es auf der Homepage des Ministeriums. „Diese Technik wird mit steigender Lebenserwartung der Gesellschaft immer wichtiger“, sagt Klaus Mueller von TWT Digital Heatlh. „Es entstehen enorme Potenziale und damit auch große Entwicklungsmöglichkeiten für Absolventen der naturwissenschaftlichen Richtung.“ Wobei mit den Chancen auch die Ansprüche steigen, wie Müller glaubt: „Für Forschende wird es immer wichtiger, einen Wissensstand zu erwerben, der die angrenzenden Disziplinen einschließt. Neben dem notwendigen Know-how des Kommunizierens gehört ein tiefgreifendes Verständnis der Informatik bzw. Informationstechnologie dazu.“
Forschung , die nah an den Menschen und Märkten ist
Die Devise heißt also: Think digital! Das gilt auch für die Chemie, wie eine Studie festhält, die der Verband der chemischen Industrie Deutschland Ende 2017 zusammen mit dem Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte unter dem Titel „Chemie 4.0“ erarbeitet hat. Sehr konkret machen die Autoren der Studie fest, wo der Unterschied zwischen Chemie 3.0 und 4.0 liegt. 3.0, das war die Ära der Globalisierung und Spezialisierung, in der Forschung kooperierten die anwendungsorientierten Entwickler in den Unternehmen mit den Grundlagenforschern der Universitäten.

Laut Studie denkt Forschung 4.0 weiter: Die Verbindung von Grundlagenwissen und Anwendungsorientierung wird heute vorausgesetzt, im nächsten Schritt gehe es bei Chemie 4.0 nun darum, die Forschung und Entwicklung in den Kundenmärkten zu differenzieren und den Kunden bei der Entwicklung mit einzubeziehen. Auch hier hilft also die digitale Technik dabei, als Forscher näher an den Menschen heranzukommen. Die Arbeit vollzieht sich daher nicht mehr hauptsächlich abgekoppelt von Menschen und Märken: Sie geschieht mittendrin.
Und: Sie geschieht nicht mehr unbedingt im Labor. Das Experiment bleibt das A und O der Forschung, jedoch gibt es immer mehr Ansätze, diese Experimente zu simulieren – sie also von Rechnern ausführen zu lassen. „In Silico“ heißt diese Methode – die Abläufe finden also im Silicium statt, sprich: in den Prozessoren. Erste Startup- Unternehmen haben sich darauf konzentriert, diese IT-Lösungen für Forscher zu entwickeln, eines davon ist „Go Silico“, ein Spin-off-Unternehmen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).
Smart wird zur Pflicht
Steigende Lebenserwartung, zunehmende Zivilisationskrankheiten sowie erhöhter Kosten- und Regulierungsdruck: Das Gesundheitswesen müsse smarter werden, um den aktuellen und künftigen Anforderungen zu genügen. Das ist die Erkenntnis einer „Global Health“- Studie, die das Beratungsunternehmen Deloitte im März 2018 vorgestellt hat. Im Zentrum neuer Ansätze und Strategien stehen laut Studie smarte Technologien: Die Patienten lieferten Daten, auch über mobile Devices wie Wearables. Cognitive Computing und cloudbasierte, interoperable Krankenakten spielten eine genauso wichtige Rolle wie das Internet der Dinge, aber auch die Datenintegrität, die bestehende Sicherheitssysteme vor große Herausforderungen stelle.
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/presse/contents/studie-2018-healthcareand-lifesciences-outlook.html
„ChromX“ ist der Name der Simulationssoftware der Firma, sie richtet sich in erster Linie an Unternehmen aus der Biopharmazie, die genug davon haben, dass die Entwicklungsschritte in ihrem Bereich so lange dauern. 95 Prozent der Laborversuche könnten durch das Softwareverfahren ersetzt und wesentlich beschleunigt werden, gibt das Unternehmen auf seiner Webseite an. „Seit einigen Jahrzehnten legt die Forschung die Grundlage für computergeführte Entwicklungen. Wir haben unseren Job gemacht“, wird dort Jürgen Hubbuch vom KIT zitiert, er ist einer der Initiatoren der Ausgründung und wissenschaftlicher Berater des Startups. Interessant: Zu den Angeboten von „Go Silicio“ zählen in erster Linie die Implementierung der Software sowie Beratung und Training.
Fachwissen nicht vernachlässigen
Diese Dienstleistungen unterscheiden sich kaum von denen eines IT-Unternehmens. Geführt wird das Start-up aber von promovierten Biotechnologen – Jürgen Hubbuch ist Professor für Bio- und Lebensmitteltechnik. Auch hier wird also deutlich, wie sehr es bei naturwissenschaftlichen Erfolgsstorys heute darauf ankommt, digital zu denken und zu arbeiten. Was natürlich nicht bedeutet, das Fachwissen zu vernachlässigen. Auf die Verzahnung kommt es an.
Lesetipp
Der Ruf vieler Geschäftsführer leidet, weil sie moralische Entscheidungen und ethische Praxis missachten, stellt der ehemalige Top-Manager Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow fest. In seinem Lehrbuch beschäftigt er sich mit Business-Ethik – einer Mischung aus Tiefenpsychologie, geistiger Weisheit, Meditation und Quantenphysik.











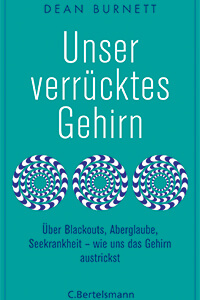 Ohne Zweifel haben wir das größte Wunderwerk der Evolution in unserem Kopf. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn das Gehirn spielt uns fortwährend Streiche: Es versetzt uns in Angstzustände, als verfolge uns der Säbelzahntiger, quält uns an Bord eines Schiffes mit Übelkeit oder entwirft ein völlig überzogenes Bild von uns selbst. Die Gründe werden im unausgeglichenen Verhältnis sehr alter primitiver Hirnteile und neuerer Regionen vermutet. So dominiert uns oft das sogenannte Reptilgehirn, und die uralte Amygdala lässt uns weiterhin Ausschau nach Gefahren halten, die es längst nicht mehr gibt – mit entsprechenden unpassenden, lästigen Reaktionsmustern. Kompetent, leicht nachvollziehbar und witzig erklärt Burnett, wie, wann und warum uns das Gehirn in die Irre führt. In seinem Buch räumt Burnett mit Märchen über das Gehirn auf und erklärt, wann es uns austrickst, ohne dass wir es merken.
Ohne Zweifel haben wir das größte Wunderwerk der Evolution in unserem Kopf. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn das Gehirn spielt uns fortwährend Streiche: Es versetzt uns in Angstzustände, als verfolge uns der Säbelzahntiger, quält uns an Bord eines Schiffes mit Übelkeit oder entwirft ein völlig überzogenes Bild von uns selbst. Die Gründe werden im unausgeglichenen Verhältnis sehr alter primitiver Hirnteile und neuerer Regionen vermutet. So dominiert uns oft das sogenannte Reptilgehirn, und die uralte Amygdala lässt uns weiterhin Ausschau nach Gefahren halten, die es längst nicht mehr gibt – mit entsprechenden unpassenden, lästigen Reaktionsmustern. Kompetent, leicht nachvollziehbar und witzig erklärt Burnett, wie, wann und warum uns das Gehirn in die Irre führt. In seinem Buch räumt Burnett mit Märchen über das Gehirn auf und erklärt, wann es uns austrickst, ohne dass wir es merken.
 Es ist eines der größten Naturwunder überhaupt, und es ist das alltäglichste und häufigste: die Metamorphose. Insekten beherrschen die Wiedergeburt aus dem eigenen Körper. Dass aus einem plumpen, raupenartigen Dauerfresser ein filigraner Schmetterling wird oder aus einer wurstförmigen Larve eine Biene, ist etwa so, als formte sich aus dem Körper eines Maulwurfs eine Giraffe – nur noch phantastischer. Die Wissenschaftsfotografen Nicole Ottawa und Oliver Meckes (World Press Photo Award, Deutscher Preis für Wissenschaftsfotografie) stellen Larve und erwachsenes Insekt in Einzelportraits einander gegenüber und dokumentieren so mit den Mitteln der Rasterelektronenmikroskopie in noch nie gesehener Detailschärfe und Brillanz einen Wandel, der nicht nur Wissenschaftler fasziniert. Nicole Ottawa, Oliver Meckes: Wandlungskünstler.
Es ist eines der größten Naturwunder überhaupt, und es ist das alltäglichste und häufigste: die Metamorphose. Insekten beherrschen die Wiedergeburt aus dem eigenen Körper. Dass aus einem plumpen, raupenartigen Dauerfresser ein filigraner Schmetterling wird oder aus einer wurstförmigen Larve eine Biene, ist etwa so, als formte sich aus dem Körper eines Maulwurfs eine Giraffe – nur noch phantastischer. Die Wissenschaftsfotografen Nicole Ottawa und Oliver Meckes (World Press Photo Award, Deutscher Preis für Wissenschaftsfotografie) stellen Larve und erwachsenes Insekt in Einzelportraits einander gegenüber und dokumentieren so mit den Mitteln der Rasterelektronenmikroskopie in noch nie gesehener Detailschärfe und Brillanz einen Wandel, der nicht nur Wissenschaftler fasziniert. Nicole Ottawa, Oliver Meckes: Wandlungskünstler.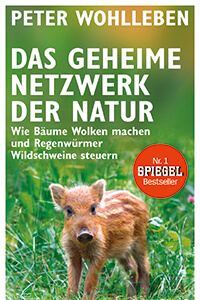 Die Natur steckt voller Überraschungen: Laubbäume beeinflussen die Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion und Nadelwälder können Regen machen. Was steckt dahinter? Der passionierte Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben lässt seine Leserinnen und Leser eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen lehrt Deutschlands bekanntester Förster einmal mehr das Staunen.
Die Natur steckt voller Überraschungen: Laubbäume beeinflussen die Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion und Nadelwälder können Regen machen. Was steckt dahinter? Der passionierte Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben lässt seine Leserinnen und Leser eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen lehrt Deutschlands bekanntester Förster einmal mehr das Staunen.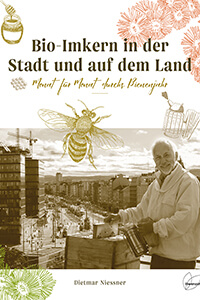 Bienen sind faszinierende Wesen. Rund 4000 Blüten fliegen sie pro Tag für Nektar an. Dabei gibt es nicht nur in ländlichen Gegenden, sondern auch in Städten reichlich Nahrung für die emsigen Arbeiterinnen. Auf Balkonen, Verkehrsinseln und in Parkanlagen wird fleißig gesammelt und bestäubt. Erfolgreiches Imkern ist also fast überall möglich, ob auf dem Dach eines Hochhauses oder im eigenen Garten. Imkermeister und Pädagoge Dietmar Niessner eröffnet mit seinem Buch einen umfassenden Rundumblick auf die spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit des Imkerns. Mit vielen Informationen, Anleitungen und Tipps zum Imkerstart erleichtert er Anfängerinnen und Anfängern den Einstieg in die Bienenhaltung und beantwortet Fragen wie: Wie viel Zeit nimmt das Imkern in Anspruch? Wo kann ich mein Bienenvolk aufstellen? Was für Aufstellungsformen gibt es? Wie kommt man überhaupt zu Bienen?
Bienen sind faszinierende Wesen. Rund 4000 Blüten fliegen sie pro Tag für Nektar an. Dabei gibt es nicht nur in ländlichen Gegenden, sondern auch in Städten reichlich Nahrung für die emsigen Arbeiterinnen. Auf Balkonen, Verkehrsinseln und in Parkanlagen wird fleißig gesammelt und bestäubt. Erfolgreiches Imkern ist also fast überall möglich, ob auf dem Dach eines Hochhauses oder im eigenen Garten. Imkermeister und Pädagoge Dietmar Niessner eröffnet mit seinem Buch einen umfassenden Rundumblick auf die spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit des Imkerns. Mit vielen Informationen, Anleitungen und Tipps zum Imkerstart erleichtert er Anfängerinnen und Anfängern den Einstieg in die Bienenhaltung und beantwortet Fragen wie: Wie viel Zeit nimmt das Imkern in Anspruch? Wo kann ich mein Bienenvolk aufstellen? Was für Aufstellungsformen gibt es? Wie kommt man überhaupt zu Bienen?
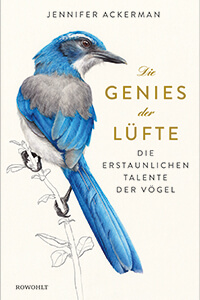 Sie überqueren Kontinente, ohne nach dem Weg zu fragen. Sie erinnern sich an die Vergangenheit und planen für die Zukunft. Sie beherrschen die Grundprinzipien der Physik. Vögel sind erstaunlich intelligente Wesen. Wie zahlreiche neue Studien zeigen, stehen die kognitiven Fähigkeiten vieler Arten denen von Primaten in nichts nach. Jennifer Ackerman ist begeisterte Vogelbeobachterin und begibt sich auf Entdeckungsreise zu den Genies der Lüfte. Sie verbindet in ihrem Buch auf elegante Weise persönliche Anekdoten und Reisereportage mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – nach der Lektüre sieht man die Wunder der Vogelwelt mit neuen Augen.
Sie überqueren Kontinente, ohne nach dem Weg zu fragen. Sie erinnern sich an die Vergangenheit und planen für die Zukunft. Sie beherrschen die Grundprinzipien der Physik. Vögel sind erstaunlich intelligente Wesen. Wie zahlreiche neue Studien zeigen, stehen die kognitiven Fähigkeiten vieler Arten denen von Primaten in nichts nach. Jennifer Ackerman ist begeisterte Vogelbeobachterin und begibt sich auf Entdeckungsreise zu den Genies der Lüfte. Sie verbindet in ihrem Buch auf elegante Weise persönliche Anekdoten und Reisereportage mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen – nach der Lektüre sieht man die Wunder der Vogelwelt mit neuen Augen.




