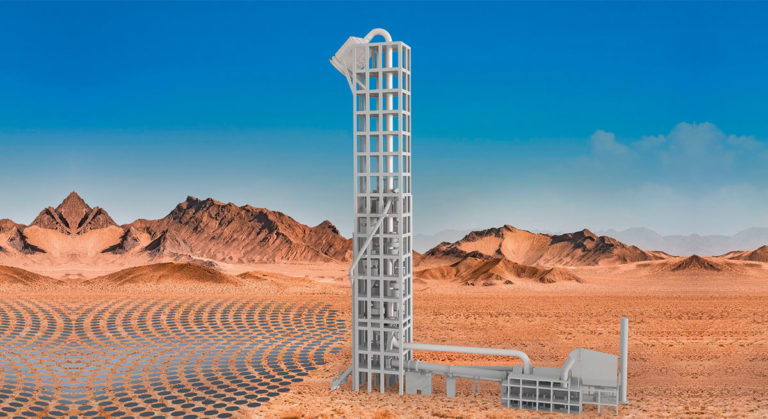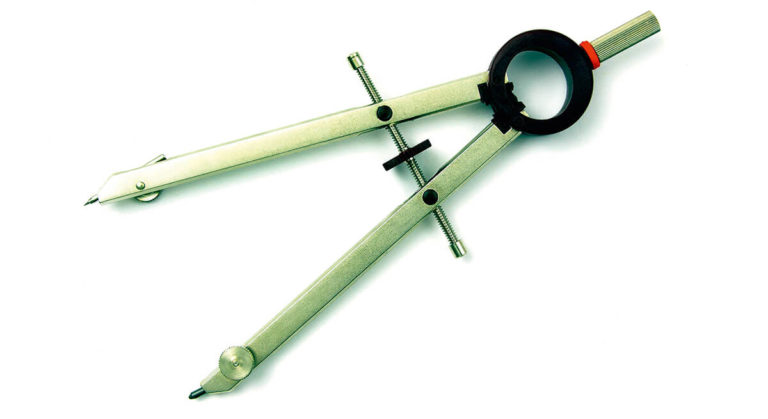Dr.-Ing. Markus König, Professor für Informatik und Bauwesen an der Ruhr-Universität Bochum, zählt in Deutschland zu den prägenden Köpfen bei der Implementierung des Building Information Modeling (BIM). Im Juli 2020 erhielt er für seine Verdienste für die Digitalisierung des Bauwesens die Konrad-Zuse- Medaille. Im Gespräch analysiert er die gegenwärtige Stellung von BIM in der deutschen Bauwirtschaft und erklärt, warum sich Bauingenieure mit Digitalisierung im Blut keine beruflichen Sorgen machen müssen. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Professor Dr.-Ing. Markus König leitet seit 2009 den Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen an der Ruhr-Universität Bochum. Dort lehrt und forscht er seit vielen Jahren zur Digitalisierung im Bauwesen. Er war Mitglied im Expertenteam des Stufenplans „Digitales Planen und Bauen“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), begleitete diverse BIM-Pilotprojekte und entwickelte verschiedene BIM-Schulungen (BIM Professional der RUB Akademie Bochum, Projektmanager BIM des DVP, BIM Schulung für das Amt für Bundesbau). Markus König ist Autor von mehr als 150 wissenschaftlichen Beitragen zur Digitalisierung im Bauwesen und Herausgeber von zwei Büchern zum Thema BIM. Seit Sommer 2019 ist er maßgeblich am Aufbau des nationalen Zentrums für Digitalisierung des Bauwesens beteiligt.
Herr König, die Vorteile von BIM liegen auf der Hand, kaum jemand bestreitet den Nutzen der Methode. Dennoch findet sie weiterhin recht schleppend Einzug in die Branche. Woran liegt das?
BIM bedeutet ja nicht nur, kurz eine neue Software zu installieren – und das war’s. Dahinter steckt eine komplette Transformation, die erfordert, dass viele Arbeitsprozesse neugestaltet werden müssen. Denn nur dann können die digitalen Modelle überhaupt erstellt und schließlich bearbeitet werden.
Wir reden also davon, dass BIM die Arbeit allumfassend verändert.
Genau, was bedeutet, dass in Behörden und Unternehmen viele Dinge passieren müssen, damit BIM funktioniert. Es geht darum, Soft- und Hardware für alle Beteiligten kompatibel zu machen, Schnittstellen zu organisieren, jeweils den Ist-Zustand zu analysieren und das Personal zu schulen. Solche Neugestaltungen von Prozessen passieren nicht von heute auf morgen.
Sie haben vor fünf Jahren ein Grundlagenbuch zum Thema BIM geschrieben, mit Blick auf das Tempo des digitalen Zeitalters ist das schon fast eine Ewigkeit her. Reden wir heute überhaupt noch über das gleiche Tool, über das sie 2015 geschrieben haben?
Schon, ja. So groß ist die Entwicklungsdynamik in der Baubranche nicht, die Grundaspekte sind heute noch die gleichen wie vor fünf Jahren. Und es ist sinnvoll, weiter damit zu arbeiten. Würden wir versuchen, immer mit den neuesten Technologien zu arbeiten, also zum Beispiel den aktuellen Trends der künstlichen Intelligenz oder der Automatisierung, würden wir viele Beteiligte eventuell überfordern. Viel gewonnen haben wir hingegen, wenn es uns gelingt, die Konzepte, die vor drei, vier Jahren entwickelt worden sind, nun in die Breite zu bringen.
Wie weit sind wir in dieser Hinsicht?
Es ist schon so, dass sich da in den vergangenen ein bis zwei Jahren einiges getan hat. Ich wohne in Dortmund, und wenn ich mir anschaue, wie Baumaßnahmen hier geplant und angegangen werden, dann erkenne ich, dass BIM-Projekte keine Exoten mehr sind. Geht das mit der Dynamik weiter, dann werden wir in vier fünf Jahren mehr BIM-Projekte als herkömmliche haben, das ist meine Prognose.
Heißt aber auch: Es könnte doch schneller gehen.
Zugegeben, als wir 2015 das Buch geschrieben haben und kurz danach den BIM-Stufenplan entwickelt und Initiativen gegründet wurden, da hatte ich gehofft, es würde schneller vorangehen. Einige Vorhabenträger waren auch sehr zügig dabei, zum Beispiel die DEGES im Straßenbau oder auch die Deutsche Bahn. Schauen wir aber in die Breite, dann passiert die Entwicklung langsamer, was auch daran liegt, dass BIM die Verwaltungsapparate durchdringen muss, und wer die Taktung der Behörden kennt, der weiß, dass das manchmal eben etwas länger dauert.
Bauingenieure gibt es sowieso schon zu wenige, Bauingenieure mit BIM-Kompetenzen sind besonders begehrt.
Wobei es ja weiterhin eine Reihe von Initiativen gibt, aktuell zum Beispiel in NRW das BIM-Competence-Center.
Ja, die gibt es, beispielsweise auch das nationale Zentrum für die Digitalisierung des Bauwesens auf Bundesebene, wobei ich mir schon wünschen würde – auch wenn ich weiß, wie schwierig das gerade jetzt in der Corona-Zeit ist, dass hier noch mehr Mittel bereitstehen würden, gerade für die Schulung von Personal. Denn das ist auf jeden Fall ein Knackpunkt: Bauingenieure gibt es sowieso schon zu wenige, Bauingenieure mit BIM-Kompetenzen sind besonders begehrt. Die Unternehmen und Behörden bekommen ihre Stellen nicht besetzt, weil der Personalmarkt nach dem Bauboom der letzten Jahre nicht mehr viel hergibt. Es wird daher nötig sein, insbesondere die Jobs in der Verwaltung attraktiver zu gestalten.
Ein Bauingenieur mit IT-Know-how muss also keine berufliche Zukunftsangst haben.
Nein, das erkenne ich auch hier bei uns am Lehrstuhl. Wenn ich jemanden frage, der Bauingenieurswissen und Digitalisierungskompetenz vereint, ob er nicht Lust hat, bei mir zu promovieren, bekomme ich in der Regel zu hören: „Das wird eng, denn ich habe schon drei, vier andere Jobangebote.“
Wie bewerten Sie denn die Ausbildung der Bauingenieure heute, erhält der Nachwuchs genügend digitale Kompetenz?
Vielfach schon, wobei es dann doch auch noch weiterhin den Kollegen oder die Kollegin gibt, die Digitalisierungsthemen am Bau skeptisch gegenübersteht. Ich stehe grundsätzlich dafür, eher mehr als weniger digitales Knowhow zu vermitteln, wobei das natürlich auch nicht auf Lasten der Fachkompetenz gehen darf: Den reinen IT-Nerd brauchen wir am Bau auch nicht. Generell stehen die Chancen in Deutschland aber gut, dass man am Ende des Studiums eine gute Ausbildung auch in Richtung Digitalisierung erhalten hat.
Ein Bauvorhaben lebt seit jeher davon, dass sich die beteiligten Akteure und Gewerke die bedeutsamen Informationen zugänglich machen.
Wie steht es um die Kommunikationsfähigkeit, eine für BIM grundlegende Kompetenz?
Kommunikation ist überaus wichtig, ja, aber das war sie schon immer. Ein Bauvorhaben lebt seit jeher davon, dass sich die beteiligten Akteure und Gewerke die bedeutsamen Informationen zugänglich machen. Geändert hat sich durch BIM die Art der Kommunikation: Es wird vielleicht weniger geredet, dafür mehr dokumentiert. Das macht Kommunikation für viele einfacher, nichtsdestotrotz muss man diese Art des digitalen Informationsaustausches natürlich beherrschen: Man erkennt heute, dass auch komplexe Projekte dann funktionieren, wenn Bauingenieure beteiligt sind, die sich auf Kommunikation verstehen und die Digitalisierung im Blut haben.
Wie steht Deutschland beim Thema BIM im internationalen Vergleich da?
Die Herausforderungen, vor denen wir in Deutschland stehen, kennen die Bauingenieure in anderen Ländern natürlich auch. Es gibt aber Unterschiede im Umgang mit dem Thema, weil es einige andere Staaten nicht ganz so genau nehmen. Nehmen Sie Großbritannien, dort ist BIM seit 2016 bereits auf dem Papier Pflicht, wodurch das Land zum Vorreiter wurde. Schaut man sich die Projekte aber genauer an, dann erkennt man, dass da zwar das BIM-Label drauf ist, viele der wirklichen Abläufe aber noch ganz ähnlich laufen wie bei uns.
Wobei diese Projekte in Deutschland noch keinen BIM-Stempel bekommen.
Genau. Das liegt daran, dass wir höhere Maßstäbe anlegen, was ein BIM-Projekt ist und was nicht. Das ist sicherlich der deutschen Ingenieurskultur geschuldet, wir nehmen es sehr genau, entwickeln viele Richtlinien bis am Ende eine DIN-Norm steht.
Konrad-Zuse-Medaille
Im Juli 2020 erhielt Markus König die Konrad- Zuse-Medaille des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), mit der er für die Digitalisierung des Bauwesens, insbesondere zur Implementierung von Building Information Modeling (BIM) in Deutschland gewürdigt wurde. Markus König habe sehr frühzeitig die Potenziale von BIM erkannt und seine Forschung stringent auf dieses Thema ausgerichtet, heißt es in der Begründung zur Preisvergabe. Wichtig sei ihm vor allem die praktische Umsetzung gewesen. Der Verband hob dabei insbesondere seine federführende Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung des Stufenplans von BIM im Infrastrukturbau hervor.
Verhindert diese deutsche Genauigkeit mitunter Innovation und Entwicklung?
Auf der einen Seite behindert diese Mentalität vielleicht das Ausprobieren von Dingen, ja. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland aber auch sehr gut darin, solche Normen zu setzen und eine hohe Qualität zu liefern. Jetzt ist es so, dass viele andere Länder gespannt auf uns gucken, weil sie ahnen: Wenn die Deutschen bald mit einer BIM-Norm um die Ecke kommen, dann wird diese sehr gut sein – und dann ist es möglich, dass wir mit diesen durchdachten Vorgaben und Regelungen die anderen sehr schnell überholen.
Muss man also nicht zwingend der Erste sein, um am Ende eine Entwicklung erfolgreich umzusetzen?
Gerade in der Baubranche geht es häufig darum, bestimmte Vorzeigeprojekte zu realisieren, die dann schnell die Runde machen. Solchen Trends zu entsprechen, ist wichtig, das gilt zum Beispiel auch für Pilotprojekte mit Baurobotern. Damit in der Öffentlichkeit zu punkten, hilft der Branche, weil neue Möglichkeiten aufgezeigt werden. Letztlich geht es aber auch darum, zu schauen, wie die Bauwirtschaft in der Breite davon profitieren kann. Und das ist in Deutschland insbesondere dann der Fall, wenn auch der Mittelstand etwas davon hat.