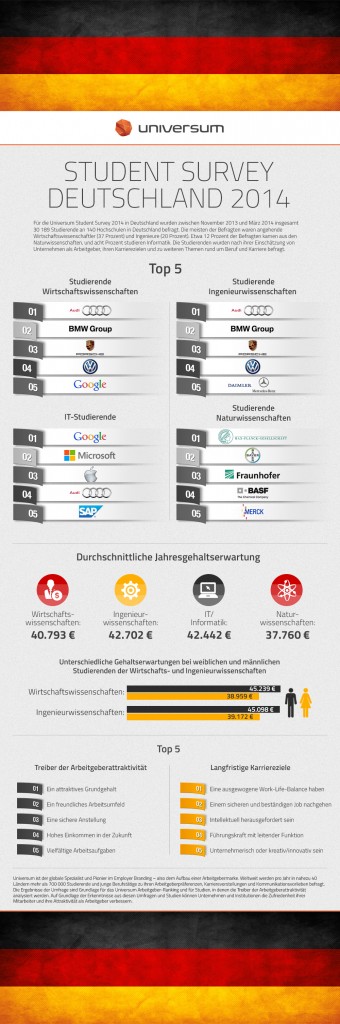Das Bankgeschäft hat sich grundlegend gewandelt. Nicht nur, dass immer neue Regularien die Geldhäuser fordern, auch der Wettbewerb wird härter und die Kunden anspruchsvoller. Daher suchen die Banken Nachwuchskräfte, die ihnen bei der Lösung dieser Herausforderungen wirklich helfen. Von André Boße
Der Berufseinstieg bei einer Bank – das war früher mal ein Schritt in vergleichsweise ruhiges Fahrwasser. Umgangssprachlich sprach man sogar von „Bankbeamten“, eine Bezeichnung, die arbeitsrechtlich nie stimmte, aber doch einen wahren Kern hatte: Wie Beamte des öffentlichen Dienstes genossen Mitarbeiter einer Bank einen sehr sicheren Arbeitsplatz ohne große Überraschungen. Dieser Zustand ist inzwischen längt passé. Heute stellt sich die Bankenwelt grundsätzlich anders dar. Erstens ist der Wettbewerb um Privat- und Geschäftskunden groß. Zweitens stehen Banken auch rund sieben Jahre nach dem Ausbruch der weltweiten Bankenkrise unter Druck: zum einen gesellschaftlich, weil die Öffentlichkeit die Geschäfte der Banken mit Argusaugen betrachtet, zum anderen politisch und rechtlich, weil Banken eine Vielzahl gesetzlicher Vorgaben zu erfüllen haben.
Verschärfter Wettbewerb und immer neue Regulierungen: Wer heute bei einer Bank einsteigt, steckt automatisch in diesem Spannungsfeld. Gefragt sind daher Typen, die sich darauf verstehen, mit diesen besonderen Rahmenbedingungen umzugehen, die je nach Art der Bank eine mehr oder weniger große Rolle spielen.
Duales Master-Studium
Wer den Bachelor in der Tasche hat, nun den Master anstrebt, dabei aber schon die Bankenbranche kennenlernen möchte, findet bei vielen Großbanken wie der Commerzbank oder der Deutschen Bank, aber auch bei Finanzdienstleistern wie MLP sowie einigen Genossenschaftsbanken die Möglichkeit für ein duales Studium, bei dem die Unternehmen direkt mit den Hochschulen kooperieren. Der Vorteil: Oft lassen sich die Studieninhalte direkt in der Praxis anwenden. Zudem hilft die Theorie der Nachwuchskraft dabei, sich in den Banken als Experte zu profilieren.
Großbank oder Genossenschaftsbank?
„Großbanken und Genossenschaftsbanken unterscheiden sich zum Teil erheblich in den Anforderungen, die an Hochschulabsolventen gestellt werden“, sagt Thomas Haibach, Geschäftsführer der Wiesbadener Personalberatung Haibach & Cie., die sich auf die Suche und Auswahl von Führungskräften und hochqualifizierten Experten für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen spezialisiert hat. Momentan suchen Großbanken für ihre jeweiligen Fachbereiche vor allem Einsteiger und Nachwuchskräfte mit fachlichem Know-how. Haibach sagt: „Hilfreich sind hier zum Beispiel Fachkenntnisse in den Bereichen Rechnungswesen oder Controlling, die im Rahmen des Studiums oder durch studienbegleitende Praktika erworben werden.“ Es kommt also vielfach auf sehr passgenaues Wissen für die jeweilige Abteilung an. Aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung seien bei Großbanken zudem sehr gute Englischkenntnisse für den Einstieg unabdingbar. „Hilfreich ist auch hier, wenn ein Bewerber bereits während seines Studiums ein Auslandspraktikum absolviert hat“, weiß der auf Banken spezialisierte Personalberater aus Erfahrung. Bei Genossenschaftsbanken wiederum ergeben sich aufgrund ihrer mittleren Größe und der regionalen Aufstellung weiterhin Einstiegsmöglichkeiten in „generalistischen Funktionen oder in der Kundenbetreuung“, erklärt Haibach.
Typ für den Wettbewerb
Um gleich ein Vorurteil zu widerlegen: Auch die regionalen Volksbanken und Sparkassen stehen heute im Wettbewerb zueinander oder zu anderen Finanzanbietern und dürfen sich daher nicht mit mittelmäßigem Personal zufrieden geben. „Ob Großbank oder Genossenschaftsbank: Alle Unternehmen brauchen hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter, um im Wettbewerb zu bestehen“, sagt Karin Reuschenbach-Coutinho, verantwortliche Karriereexpertin bei der Frankfurt School of Finance & Management. Laut dem „Bankenbarometer 2014“ der Unternehmensberatung Ernst & Young sehen die Banken in Deutschland ihre größten Geschäftsperspektiven derzeit in den Bereichen Retail Banking sowie dem gehobenen Privatkundengeschäft. Hier geht es darum, Kunden auf dem offenen und dynamischen Markt der Banken zunächst von den eigenen Leistungen zu überzeugen – und sie dann nicht zu enttäuschen, denn immer wieder zeigt sich: Kunden sind heute viel schneller bereit, ihre Bank zu wechseln, als das früher der Fall war. Welche entscheidende Rolle dabei der Service spielt, zeigt der Report „Effektives Kundenmanagement im Retail Banking“ der Unternehmensberatung PwC. In dem heißt es: „42 Prozent der Kunden wechseln die Bank, weil sie mit dem Service unzufrieden sind.“
Diesen Serviceanspruch haben nicht nur die Privatkunden, auch das Firmenkundengeschäft ist vom Wettbewerb geprägt. Ein Bereich mit ebenfalls besonders guten Perspektiven ist das Commercial Banking. „Hier geht es darum, individuelle Finanzlösungen für DAX-Konzerne zu schaffen und so international tätige Unternehmen in ihrem Geschäft und dessen Expansion zu unterstützen“, sagt Meike Keber, Referentin Personalentwicklung bei der Ing-Diba. Im Commercial Banking sind vor allem engagierte Kundenbetreuer gefragt, Experten für Finanzprodukte sowie Analysten, die „durch fachliche Expertise, interkulturelle Kompetenz sowie das nötige Fingerspitzengefühl den Kunden im Fokus haben und für ihn den besten Service liefern“, sagt Meike Keber. Commercial Banking ist daher ein ideales Einstiegsfeld für Absolventen, die gerne unternehmerisch denken und Freude daran haben, mit hoher Eigenverantwortung ein dynamisches Geschäftsfeld aufzubauen. Da der Bereich im Kern ein internationales Geschäft ist, erwarten die Banken von Einsteigern die Bereitschaft zu Auslandsaufenthalten und der Pflege internationaler Kundenbeziehungen.
Ob im Geschäft mit Privat- oder Gewerbekunden: Der „Bankmonitor 2014“ zeigt, dass deutsche Banken in naher Zukunft am ehesten in den Aufbau neuer Kanäle und Technologien für den Vertrieb investieren möchten. „Die Vernetzung von IT und Banking schafft weitere spannende und zukunftsweisende Berufszweige“, schätzt Karin Reuschenbach-Coutinho von der Frankfurt School of Finance & Management. Durch die weiter zunehmende Technisierung im Banking werden ihrer Ansicht nach Arbeitsplätze in den Filialen weiter an Bedeutung verlieren. Das gilt insbesondere für die großen internationalen Banken, in denen die Geschäftsfelder vielfach neu strukturiert werden. „Dadurch konzentrieren sich viele Abteilungen in den Zentralen der Institute“, erklärt die Expertin für Bankkarrieren. Wer sich also als Typ für die Arbeit in Filialen betrachtet, findet Tätigkeitsfelder in den auch heute noch regional stark vertretenen Genossenschaftsbanken und Sparkassen – wobei auch hier weiterhin Fusionen dafür sorgen werden, dass die Zentralen der Unternehmen größer werden und das Filialnetz tendenziell ausgedünnt wird.
Typ für Regeln
Die vielfältigen Auswirkungen der Krise fordern die Banken nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, auch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Finanzbranche stellen die Unternehmen vor immense Herausforderungen. Prozesse und Projekte müssen hinterfragt werden, in vielen Geldhäusern steht sogar die gesamte Unternehmenskultur auf dem Prüfstand – und das funktioniert in den Banken nicht ohne speziell dafür ausgebildetes Personal. „Themen wie Compliance, Risk Management und Corporate Governance gewinnen daher weiter an Bedeutung. In diesen Bereichen entstehen neue und fordernde Tätigkeitsfelder für angehende Banker“, prognostiziert Karin Reuschenbach-Coutinho.
Konkret suchen die Banken laut Personalberater Thomas Haibach verstärkt Einsteiger und Nachwuchskräfte für den Bereich Audit. Intern und unabhängig vom Tagesgeschäft prüfen hier Compliance-Experten die Geschäftsfelder der Bank. Sie machen sich auf die Suche nach möglicherweise nicht regelkonformen Teilbereichen des operativen Geschäfts, nehmen die verschiedenen Finanzdienstleistungen unter die Lupe und analysieren die internen Prozesse und Strukturen. Besonders für große Banken werden diese Compliance- und Audit-Experten immer wichtiger: Sie stellen sicher, dass Banken regelkonform ihrem Geschäft nachgehen. Das schützt die Institute vor möglichen Strafen. Dementsprechend gut sind die Karrierechancen für Einsteiger, die sich in diesem Bereich profilieren können. Und zukunftssicher ist der Bereich auch, weil die Zeit der Regulierungen noch nicht vorbei ist. Seit Anfang 2014 ist zum Beispiel die neu verfasste Richtlinie über Eigenkapitalanforderungen in Europa in vollem Umfang in Kraft getreten, nach der Banken eine noch höhere Liquidität und ein höheres Eigenkapital vorweisen müssen.
Typ fürs Risiko
Auch abseits der Regeln hat die Bankenkrise die Jobprofile der Branche geändert. Sehr gefragt sind demnach Nachwuchskräfte, die sich auf das Abschätzen und die Quantifizierung von Risiken für die Institute verstehen. Dabei kommt es darauf an, Risiken zu erkennen und durch mathematische und statistische Methoden zu analysieren. Am Ende des Prozesses sollte dabei ein Ergebnis stehen, aus dem die Risiken und Chancen hervorgehen. „Gefragt sind hier Mitarbeiter, die sich immer wieder mit neuen Aufgaben befassen wollen, neue Entwicklungen antizipieren können und die Sicherheit für Kunden und Bank in den Vordergrund stellen“, erläutert Meike Keber von der Ing-Diba. Man darf sich Jobs im Risikomanagement jedoch nicht so vorstellen, dass Experten im stillen Kämmerlein basteln und analysieren. „Chancen haben kommunikative Typen“, sagt Meike Keber, „denn man arbeitet an vielen Schnittstellen mit Kollegen zusammen und findet im Dialog adäquate Lösungen.“ Ihr Wunschprofil für Talente im Risikomanagement: „Problemlöser, die das große Ganze verstehen – und sich trotzdem auf das Wesentliche konzentrieren.“
Praxiserfahrung
Mit ihren vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten bietet die Finanzwelt Absolventen die Qual der Wahl. Oft ist es gar nicht so einfach herauszufinden, welches Jobprofil am besten passt. Da hilft manchmal nur eins: hinein in die Praxis. Denn wer in den Unternehmen diverse Stationen ausprobiert, erkennt recht schnell, was ihm Spaß macht und wo die eigenen Talente liegen. Karriereexperten empfehlen daher studienbegleitende Tätigkeiten als Werkstudent oder – auch nach dem Studium – das Absolvieren von Praktika, um in der Praxis die Anforderungen der spezifischen Tätigkeitsprofile in den Fachbereichen zu erkennen.
Quelle: Thomas Haibach, Haibach & Cie.