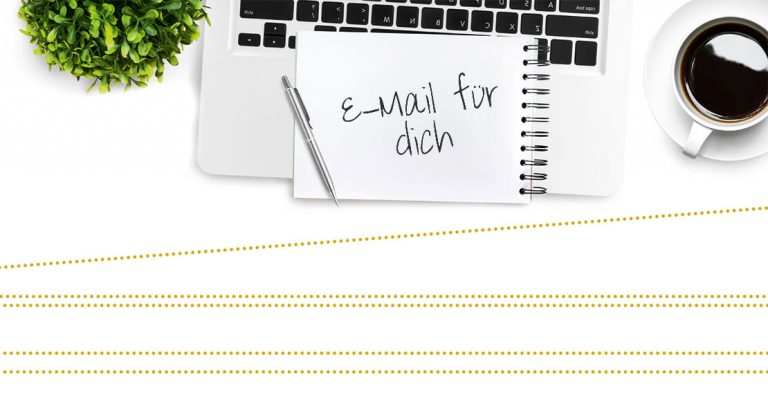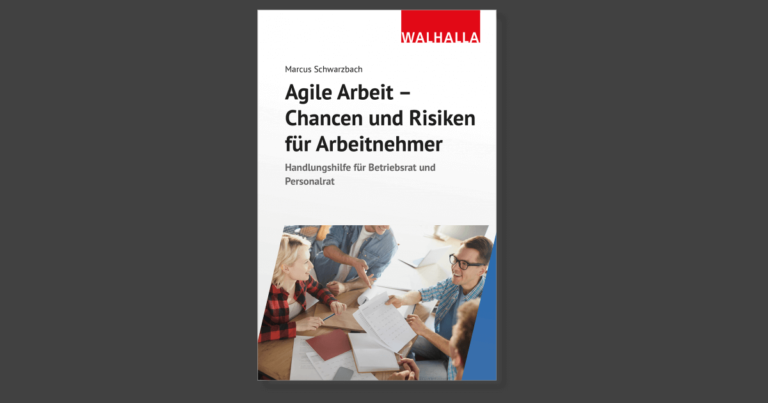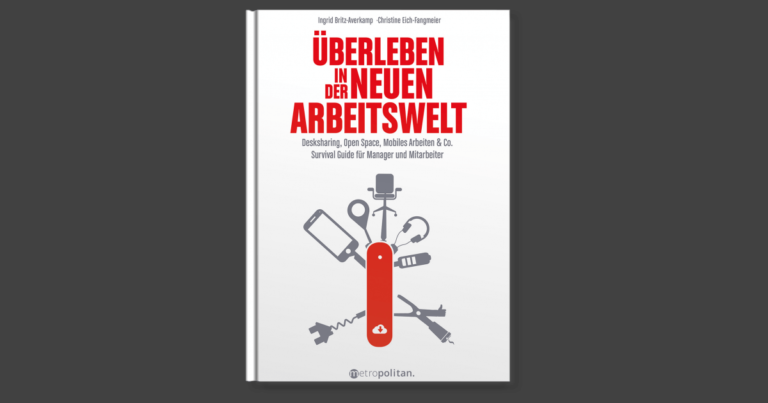Geht es nach Stefan Schillberg, schlägt in diesem Jahrzehnt die große Stunde der Pflanzen. Einsetzbar sind sie als nachwachsende Rohstoffe und Lieferanten für pharmazeutische Wirkstoffe – nicht zuletzt im Kampf gegen COVID-19. Dabei werde ihr Potenzial noch gar nicht voll ausgeschöpft, sagt der Leiter des Bereichs Molekulare Biotechnologie am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME. Das Interview führte André Boße.
Zur Person
Prof. Dr. Stefan Schillberg ist kommissarisches Mitglied der Institutsleitung des Fraunhofer IME und dort Leiter des Bereichs Molekulare Biotechnologie mit Sitz in Aachen. Schillberg promovierte 1994 am Institut für Pflanzenphysiologie der RWTH Aachen, wo er danach als PostDoc und Gruppenleiter seine berufliche Karriere begann. Seit 2001 ist er am Fraunhofer IME, wo er zunächst die Abteilung Pflanzenbiotechnologie leitete, seit 2009 ist er dort Leiter des Bereichs Molekularbiologie. Seit 2011 hält er zudem eine Honorar-Professur am Institut für Phytopathologie der Justus-Liebig-Universität Gießen inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt das Molekulare Farming, bei dem Proteine und Wirkstoffe aus Pflanzen gewonnen werden.
Herr Prof. Dr. Schillberg, das Fraunhofer Institut – auch das Fraunhofer IME, für das Sie tätig sind – setzt auf das Prinzip der angewandten Forschung, was kann man sich konkret darunter vorstellen?
Unser Auftrag als Fraunhofer Institut ist es, Dinge von der Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen. Das gelingt, indem die Wirtschaft mit konkreten Aufträgen auf uns zukommt oder wir das, was wir leisten können, gezielt für die Wirtschaft und die Öffentlichkeit anbieten. Wichtig ist daher, dass alle, die für die Fraunhofer arbeiten, ein Gespür dafür haben, was die Wirtschaft will.
Wenn sie es denn selbst weiß …
Das ist tatsächlich manchmal ein Balanceakt. Wichtig für uns ist, dass wir unser eigenes, auf der Forschung basierendes Denken behalten. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass die Wirtschaft unsere Erkenntnisse schnell anwenden möchte, wir aber sagen: Es ist klug, noch etwas in die Tiefe zu gehen, um dann ein besseres Produkt entwickeln zu können.
Wobei viele der großen Unternehmen ja auch selbst Forschung betreiben.
Das stimmt, insbesondere bei vielen großen Konzernen im Bereich Life- Science ist das der Fall, hier liegt dann die Herausforderung bei uns, entweder etwas Neues anbieten zu können – oder besser zu sein.
In welchen Bereichen können Sie hier besonders gut punkten?
Ich glaube, wir sind gut darin, innovative Ideen zu entwickeln. Wir sind nah an den neuesten Forschungsergebnissen dran, verfügen fast immer über direkte Anbindungen an die Universitäten, zum Beispiel dadurch, dass die jeweiligen Institutsleiter eine Professur an den lokalen Hochschulen besetzen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort Lehraufträge wahrnehmen und viele Bachelor- und Master-Studierende sowie Doktoranden bei uns ihre Arbeiten anfertigen.
Im Zuge der Pandemie hat die Öffentlichkeit viel darüber gelernt, wie wichtig es ist, dass sich Forschung, Politik und Wirtschaft gemeinsam einem Problem widmen. Betrachten Sie das als einen positiven Effekt dieser Corona- Krise?
Absolut, wobei sich schon beim Thema des Klimawandels abgezeichnet hat, dass aufmerksam beobachtet wird, was die Forschung zur Lösung des Problems beitragen kann. Für uns kann das nur von Vorteil sein. Ich finde sogar, die Politik könnte es noch forcieren, indem sie zum Beispiel deutlicher herausstellt, welche Forschungsmittel wohin fließen – und welche Erkenntnisse am Ende des Tages gewonnen werden.
„Pflanzen bieten ein alternatives System, um Proteine zu produzieren, die in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden, zum Bespiel für Impfstoffe.“ „Unsere Aufgabe ist es, die Pflanze wettbewerbsfähig zu machen, in dem wir innovative Produkte entwickeln.“
Der Standort Aachen des Fraunhofer IME, an dem Sie tätig sind, widmet sich der Molekularen Biotechnologie. Zum Thema Fraunhofer und Corona haben Sie den Hashtag #WeKnowHow entwickelt, was tragen Sie zum Kampf gegen die Pandemie bei?
Pflanzen bieten ein alternatives System, um Proteine zu produzieren, die in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden. Zum Bespiel für Impfstoffe. Ein wichtiger Vorteil der Pflanzen gegenüber anderen konventionellen Systemen ist, dass die Proteine sehr schnell produziert und aus den Pflanzen gereinigt werden können. Wir sprechen hier von einer Prozessdauer von drei bis fünf Tagen, und das schafft kaum ein anderes System. Müssen jetzt, wie in der Pandemie, sehr schnell große Mengen an Proteinen bereitgestellt werden, für den Impfstoff, aber auch für diagnostische Tests, bietet der Ansatz der Proteinproduktion in Pflanzen Vorteile. Denn es ist ja nicht so, dass die bisherigen Produktionskapazitäten für Proteine komplett umgewidmet werden können, wir brauchen die anderen pharmazeutischen Anwendungen ja auch weiterhin. Die Stärke der Pflanze als Proteinlieferant ist es, sehr schnell in diese Lücke reinspringen zu können – zum Beispiel als Produzent von diagnostischen Proteinen wie viralen Antigenen.
Können denn die pflanzlich gewonnenen Proteine in der Qualität mithalten?
Ja, für einige Anwendungen ist deren Qualität sogar besser, zum Beispiel aufgrund der Zusammensetzung von Zuckermolekülen, die dem Protein angeheftet werden.
Der Klimawandel wird uns als Problem deutlich länger beschäftigten als die Pandemie. Was kann Ihre Forschungsarbeit hier leisten?
Wir erkennen, dass die konventionelle Landwirtschaft nicht nur sehr viele Ressourcen verbraucht, sondern auch einen großen Teil des CO2-Ausstoßes verursacht. Eines unserer Forschungsfelder sucht daher nach neuen Agrarsystemen. Stichworte sind hier zum Beispiel Indoor- oder Vertical-Farming. Die Idee: Pflanzen werden in einem Gebäude vertikal über mehrere Ebenen angebaut. Wir haben hier verschiedene Anlagen konzipiert und führen gerade Studien durch, inwieweit diese dazu beitragen können, die CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Landwirtschaft resilienter zu machen.
„Unsere Innovationen können der Landwirtschaft mehr Robustheit in Krisenfällen geben, zum Beispiel in Pandemien, aber auch mit Blick auf die Auswirkungen der Erderwärmung wie Dürren.“
Was heißt Resilienz hier konkret?
Unsere Innovationen können der Landwirtschaft mehr Robustheit in Krisenfällen geben, zum Beispiel in Pandemien, aber auch mit Blick auf die Auswirkungen der Erderwärmung wie Dürren. Dabei ist die Bio-Ökonomie generell eine Forschungsrichtung, die in Zukunft wichtiger werden wird – und zwar insbesondere, um unsere erdölbasierte in eine biobasierte Wirtschaft zu transferieren. Hier gibt es unzählige Beispiele dafür, wie Pflanzen helfen können, zum Beispiel als nachwachsende Rohstoffe für die Energiegewinnung oder für die Entwicklung von Baustoffen.
Warum steht die Pflanze eigentlich trotz Ihrer ökologischen und auch ökonomischen Vorteile nicht viel höher auf der Agenda?
Es gab und gibt eben noch Alternativen, wie zum Beispiel das Erdöl. Hier haben sich Strukturen und feste Wirtschaftszweige etabliert, das ist letzten Endes immer auch eine Frage des Geldflusses. Nach und nach erkennen wir jedoch die negativen Folgen, sodass nachwachsende Rohstoffe in den Fokus geraten. Unsere Aufgabe ist es dabei, die Pflanze nun wettbewerbsfähig zu machen, in dem wir innovative Produkte entwickeln.
Zu Ihren Forschungsfeldern gehört auch die Bio-Genetik, wobei sich die Deutschen diesem Bereich sehr vorsichtig, wenn nicht sogar ablehnend positionieren.
Ja, und das Thema bleibt schwierig, was auch daran liegt, dass die Diskussion meiner Meinung nach ein wenig an der Realität vorbeigeht. Vielfach wird suggeriert, dass die Nahrungsmittel, die wir heute in Deutschland kaufen können, auf ganz natürliche Weise hergestellt werden. Das ist aber nicht der Fall. Wer sich die Produkte genauer anschaut, erkennt, dass bereits heute 90 Prozent der pflanzlichen Nahrung und Futtermittel mithilfe von Mutationszüchtungen hergestellt werden.
Zum Fraunhofer IME
Das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME umfasst die drei Bereiche Molekulare Biotechnologie, Angewandte Oekologie und Bioressourcen sowie Translationale Medizin. Es versteht sich als Partner für Forschung in den Bereichen Pharma, Medizin, Chemie, Bioökonomie, Landwirtschaft sowie Umwelt- und Verbraucherschutz. Die Forschungs- und Dienstleistungsangebote richten sich dabei an die Industrie sowie die öffentliche Hand. Das Institut beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an den Standorten Aachen, Münster, Schmallenberg, Gießen, Frankfurt/Main und Hamburg. Stets gibt es eine enge Verknüpfung zu den Hochschulen an den jeweiligen Standorten.





 Go for it! Start in die Dekade der Naturwissenschaften
Go for it! Start in die Dekade der Naturwissenschaften


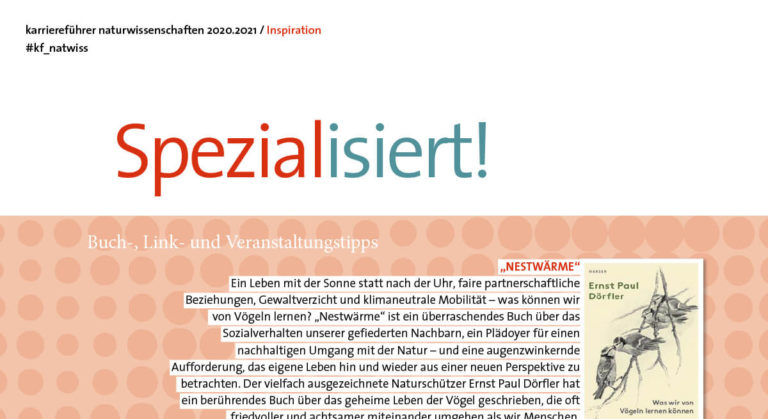
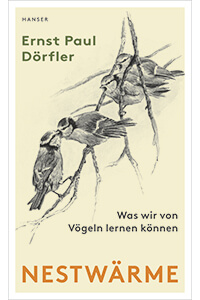 Ein Leben mit der Sonne statt nach der Uhr, faire partnerschaftliche Beziehungen, Gewaltverzicht und klimaneutrale Mobilität – was können wir von Vögeln lernen? „Nestwärme“ ist ein überraschendes Buch über das Sozialverhalten unserer gefiederten Nachbarn, ein Plädoyer für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur – und eine augenzwinkernde Aufforderung, das eigene Leben hin und wieder aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Der vielfach ausgezeichnete Naturschützer Ernst Paul Dörfler hat ein berührendes Buch über das geheime Leben der Vögel geschrieben, die oft friedvoller und achtsamer miteinander umgehen als wir Menschen. Ernst Paul Dörfler: Nestwärme. Hanser Verlag 2019. ISBN 978-3-446-26357-4. 20 Euro
Ein Leben mit der Sonne statt nach der Uhr, faire partnerschaftliche Beziehungen, Gewaltverzicht und klimaneutrale Mobilität – was können wir von Vögeln lernen? „Nestwärme“ ist ein überraschendes Buch über das Sozialverhalten unserer gefiederten Nachbarn, ein Plädoyer für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur – und eine augenzwinkernde Aufforderung, das eigene Leben hin und wieder aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Der vielfach ausgezeichnete Naturschützer Ernst Paul Dörfler hat ein berührendes Buch über das geheime Leben der Vögel geschrieben, die oft friedvoller und achtsamer miteinander umgehen als wir Menschen. Ernst Paul Dörfler: Nestwärme. Hanser Verlag 2019. ISBN 978-3-446-26357-4. 20 Euro
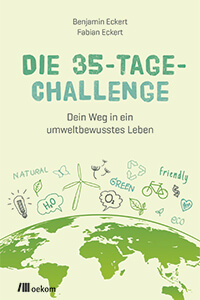 In nur fünf Wochen das eigene Leben nachhaltig umkrempeln? Wie das geht zeigen Benjamin und Fabian Eckert. Sie schlagen in ihrem Buch eine 35-Tage-Challenges vor, die den Umstieg in ein ressourcenarmes, klimaschonendes Leben erleichtert. Die zahlreichen Informationen, Tipps und praktischen Anleitungen verknüpfen dabei Klimaschutz mit individuellen Aspekten wie gesundheitlichem Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Benjamin Eckert, Fabian Eckert: Die 35-Tage-Challenge. Dein Weg in ein umweltbewusstes Leben. Oekom 2020. ISBN 978-3-96238-175-2. 19 Euro
In nur fünf Wochen das eigene Leben nachhaltig umkrempeln? Wie das geht zeigen Benjamin und Fabian Eckert. Sie schlagen in ihrem Buch eine 35-Tage-Challenges vor, die den Umstieg in ein ressourcenarmes, klimaschonendes Leben erleichtert. Die zahlreichen Informationen, Tipps und praktischen Anleitungen verknüpfen dabei Klimaschutz mit individuellen Aspekten wie gesundheitlichem Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit. Benjamin Eckert, Fabian Eckert: Die 35-Tage-Challenge. Dein Weg in ein umweltbewusstes Leben. Oekom 2020. ISBN 978-3-96238-175-2. 19 Euro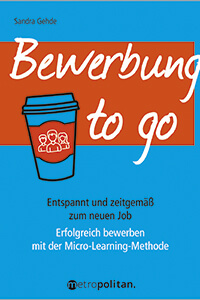 Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit einem Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, und die keine Lust haben, zu googeln, wie viele Leerzeilen zwischen Anschrift und Anrede stehen sollen. Denn für das perfekte Anschreiben reichen schon 15 Minuten, zeigt Sandra Gehde in ihrem neuen Buch. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro
Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit einem Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, und die keine Lust haben, zu googeln, wie viele Leerzeilen zwischen Anschrift und Anrede stehen sollen. Denn für das perfekte Anschreiben reichen schon 15 Minuten, zeigt Sandra Gehde in ihrem neuen Buch. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro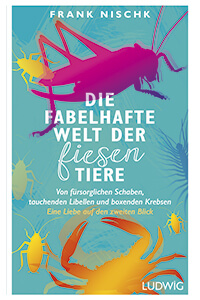 Was hat eine Grille mit einem Streichinstrument gemeinsam? Gibt es tatsächlich Käfer, die ihre Leuchtorgane dimmen können? Und wie kann es sein, dass man Heuschrecken einer bestimmten Spezies mal mit roten, mal mit grünen Beinen findet? Nur eine Laune der Natur, oder hat die Evolution hier eine neue Art hervorgebracht? Kakerlaken, Ameisen, Wespen, Quallen und Würmer – oft sind es die unscheinbaren, die stechenden, die vermeintlich ekligen Tierchen, die uns mit ihren faszinierenden Geschichten besonders überraschen. Frank Nischk: Die Fabelhafte Welt der fiesen Tiere“. Ludwig 2020. ISBN: 978-3-453-28114-1. 20,00 Euro
Was hat eine Grille mit einem Streichinstrument gemeinsam? Gibt es tatsächlich Käfer, die ihre Leuchtorgane dimmen können? Und wie kann es sein, dass man Heuschrecken einer bestimmten Spezies mal mit roten, mal mit grünen Beinen findet? Nur eine Laune der Natur, oder hat die Evolution hier eine neue Art hervorgebracht? Kakerlaken, Ameisen, Wespen, Quallen und Würmer – oft sind es die unscheinbaren, die stechenden, die vermeintlich ekligen Tierchen, die uns mit ihren faszinierenden Geschichten besonders überraschen. Frank Nischk: Die Fabelhafte Welt der fiesen Tiere“. Ludwig 2020. ISBN: 978-3-453-28114-1. 20,00 Euro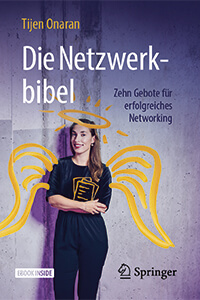 Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch komplexer geworden: es gibt ein Überangebot an digitalen Plattformen, immer mehr Events und immer mehr Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: ein tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für Berufseinsteiger. Tijen Onaran zeigt, wie Networking heute wirklich funktioniert. In ihrem ersten Buch gibt die Autorin eigene Erfahrungen weiter, reflektiert ihre Erlebnisse, erzählt Anekdoten aus ihrer Zeit in der Politik und Wirtschaft und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Tijen Onaran: Die Netzwerkbibel. Springer 2019. ISBN 978-3-658-23735-6. 19,99 Euro
Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch komplexer geworden: es gibt ein Überangebot an digitalen Plattformen, immer mehr Events und immer mehr Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: ein tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für Berufseinsteiger. Tijen Onaran zeigt, wie Networking heute wirklich funktioniert. In ihrem ersten Buch gibt die Autorin eigene Erfahrungen weiter, reflektiert ihre Erlebnisse, erzählt Anekdoten aus ihrer Zeit in der Politik und Wirtschaft und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Tijen Onaran: Die Netzwerkbibel. Springer 2019. ISBN 978-3-658-23735-6. 19,99 Euro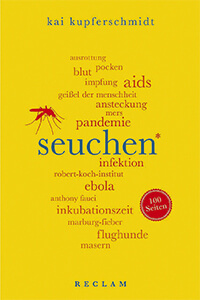 Seuchen sind die Geißeln der Menschheit. Die Pest entvölkerte ganze Landstriche, Choleraepidemien forderten bis ins 20. Jahrhundert hinein Millionen Tote, mit HIV trat in den 1980er-Jahren eine völlig neue, zunächst unbeherrschbare Krankheit auf, heute versetzen uns Ebola, Sars, Vogelgrippe und Corona in Angst. Woher kommen die Erreger dieser Seuchen, warum führen manche von ihnen zu Epidemien? Aber vor allem: Was können Medizin und Forschung dagegen tun? Fachlich fundiert erzählt Kai Kupferschmidt die lange, teils krimiartige Geschichte eines vielgestaltigen Phänomens, deren Ende – man ahnt es – nicht absehbar ist. Kai Kupferschmidt: Seuchen. Reclam 2018. ISBN 978-3-15-020447-4. 10 Euro.
Seuchen sind die Geißeln der Menschheit. Die Pest entvölkerte ganze Landstriche, Choleraepidemien forderten bis ins 20. Jahrhundert hinein Millionen Tote, mit HIV trat in den 1980er-Jahren eine völlig neue, zunächst unbeherrschbare Krankheit auf, heute versetzen uns Ebola, Sars, Vogelgrippe und Corona in Angst. Woher kommen die Erreger dieser Seuchen, warum führen manche von ihnen zu Epidemien? Aber vor allem: Was können Medizin und Forschung dagegen tun? Fachlich fundiert erzählt Kai Kupferschmidt die lange, teils krimiartige Geschichte eines vielgestaltigen Phänomens, deren Ende – man ahnt es – nicht absehbar ist. Kai Kupferschmidt: Seuchen. Reclam 2018. ISBN 978-3-15-020447-4. 10 Euro.