Wer bei der KI an eine Superintelligenz denkt, die das Beste aus Menschen und Maschine kombiniert, sollte sich auf eine Enttäuschung gefasst machen. Da könne man ja auch versuchen, Leitern miteinander zu verbinden, bis man den Mond erreicht, wie ein Informatikprofessor aus Princeton vergleicht. Statt auf eine moralischmenschliche KI zu bauen, sollten wir Systeme entwickeln, die Probleme, Chancen und Ungerechtigkeiten offenlegen. Die Dinge dann zum Besseren zu verändern? Ist und bleibt die Aufgabe des denkenden Menschen. Ein Essay von André Boße
Die US-Digitalexpertin und Autorin Frederike Kaltheuner hat eine Anthologie über die Künstliche Intelligenz geschrieben, die den für diese Zukunftstechnik wenig schmeichelhaften Titel „Fake AI“ trägt. Für das im Netz frei zugängliche Buch (zu finden unter: fakeaibook.com) haben diverse Autor*innen über die KI geschrieben. Zum Einstieg hat Frederike Kaltheuner den Informatik-Professor Arvind Narayanan interviewt, Hochschullehrer in Princeton, laut Ranking weltweit die elfwichtigste Hochschule im Bereich Computer Science. Wer hier lehrt, der beherrscht sein Fach. Im Interview sagt der Princeton-Professor einen bemerkenswerten Satz, im englischen Original lautet er: „Much of what is sold commercially today as ‘AI’ is what I call ‘snake oil’.“ Auf Deutsch: Vieles von dem, was heute unter dem Label KI verkauft werde, bezeichne er als „Schlangenöl“.
Gemeint ist öliges Zeug, das zur Zeit des Wilden Westens von vermeintlichen Wunderheilern bei ihren „Medicine Shows“ verscherbelt wurde, gekoppelt an das Versprechen, diese Tinkturen würden gegen diverse Leiden helfen.
Gemeint ist öliges Zeug, das zur Zeit des Wilden Westens von vermeintlichen Wunderheilern bei ihren „Medicine Shows“ verscherbelt wurde, gekoppelt an das Versprechen, diese Tinkturen würden gegen diverse Leiden helfen. Der Begriff hat es viele Jahre später von der Prärie in die Welt der Software geschafft: Als „snake oil“ werden IT-Produkte bezeichnet, die Bemerkenswertes versprechen, davon jedoch fast nichts halten, zum Beispiel in der Praxis nutzlose Antiviren-, Festplattenaufräum- oder Arbeitsspeicherverdoppelungsprogramme. Arvind Narayanan trifft also ein hartes Urteil über viele der Versprechen der KI, macht aber eine wichtige Differenzierung: „Some are not snake oil.“ Einige Künstliche Intelligenzen wirkten, andere nicht. Wo also liegt der Unterschied?
Superintelligenz? Schlangenöl!
Seine Kritik fokussiert Arvind Narayanan an eine „Artificial General Intelligence“ (AGI), eine Allgemeine Künstliche Intelligenz, die in der Lage sei, nahezu jede intellektuelle Aufgabe zu erlernen. Eine solche Superintelligenz würde also das Problembewusstsein eines Menschen mit der Rechengeschwindigkeit von Supercomputern kombinieren; sie arbeite damit nicht mehr aufgabenspezifisch, sondern generell. Umfragen zeigten, sagt Narayanan, dass viele Menschen glaubten, diese Form von AGI stehe kurz vor der Realisation – womit ein Wendepunkt der menschlichen Zivilisation kurz bevorstehe. „I don’t think that’s true at all“, hält Narayanan dagegen. Er beschreibt die Vorstellung, die aktuellen Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz könnten zu einer solchen „Artificial General Intelligence“ führen, mit dem Versuch, eine immer längere Leiter zu bauen, um damit den Mond zu erreichen. Kurz: die Vorstellung einer AGI sei „absurd.“
„Maschinen wie ich“
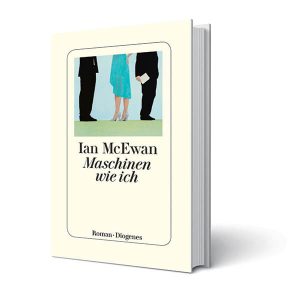 Ian McEwan imaginiert in diesem kühnen Roman die Vergangenheit neu: In einer Welt, die ein wenig anders ist als die unsere, stellt ein Roboter ein junges Liebespaar vor ein gefährliches Dilemma. London, 1982: Großbritannien hat gerade den Falkland-Krieg verloren, und dank der Forschung von Alan Turing gibt es Anfang der achtziger Jahre schon Internet, Handys und selbstfahrende Autos – und die ersten täuschend echten künstlichen Menschen. Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30, ist seit seiner Kindheit von Künstlicher Intelligenz fasziniert, Alan Turing ist sein Idol. Auch wenn es ihn ein kleines Vermögen kostet, kauft er sich sofort einen der ersten Androiden, die auf den Markt kommen. Charlie wünscht sich einen Freund, einen Helfer, einen interessanten Gesprächspartner. Er erhält viel mehr als das: einen Rivalen um die Liebe der schönen Miranda und eine moralische Herausforderung, die ihn bis zum Äußersten reizt. Ian McEwan: Maschinen wie ich. Diogenes 2019. ISBN 978-3-257-60958-5. 11,99 Euro.
Ian McEwan imaginiert in diesem kühnen Roman die Vergangenheit neu: In einer Welt, die ein wenig anders ist als die unsere, stellt ein Roboter ein junges Liebespaar vor ein gefährliches Dilemma. London, 1982: Großbritannien hat gerade den Falkland-Krieg verloren, und dank der Forschung von Alan Turing gibt es Anfang der achtziger Jahre schon Internet, Handys und selbstfahrende Autos – und die ersten täuschend echten künstlichen Menschen. Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30, ist seit seiner Kindheit von Künstlicher Intelligenz fasziniert, Alan Turing ist sein Idol. Auch wenn es ihn ein kleines Vermögen kostet, kauft er sich sofort einen der ersten Androiden, die auf den Markt kommen. Charlie wünscht sich einen Freund, einen Helfer, einen interessanten Gesprächspartner. Er erhält viel mehr als das: einen Rivalen um die Liebe der schönen Miranda und eine moralische Herausforderung, die ihn bis zum Äußersten reizt. Ian McEwan: Maschinen wie ich. Diogenes 2019. ISBN 978-3-257-60958-5. 11,99 Euro.
Bei den Bereichen, in denen die Menschen laut Arvind Narayanan besonders anfällig für „Schlangenöl-KI“ seien, steche eines besonders hervor: das Recruiting. Dass man hier auf Künstliche Intelligenz hoffe, liege daran, dass die Not hier besonders groß sei – weil halt niemand vorhersagen könne, ob eine neu eingestellte Person tatsächlich im Job überzeugen werde oder nicht. Recruiting ist ein Spiel im Nebel – umso begieriger greife man zum „Snake Oil“, in der Hoffnung, dass die KI diesen Nebel lichten möge. Was sie natürlich nicht könne: Es gebe, sagt Arvind Narayanan im Interview im Buch „Fake AI“, mittlerweile eine Reihe wissenschaftlicher Studien, die gründlich der Frage nachgegangen seien, wie gut KI-Systeme darin sind, soziale Folgen von Entscheidungen abzuschätzen, zum Beispiel der, wen man für einen neuen Job einstellt und wen nicht. Das Ergebnis: „Die KI schneidet gerade so besser als der Zufall ab.“
Recruiting mithilfe von KI
Eine Meldung zu den Human Ressource-Trends für das Jahr 2022 des Talent-Lösungs-Anbieters Robert Half scheint dieser Ansicht zu widersprechen. KI werde „bei der Suche nach geeigneten Bewerber*innen eine unterstützende Rolle spielen“, wird Sven Hennige, Senior Managing Director Central Europe bei Robert Half, in einer Pressemeldung zu HR-Trends im Jahr 2022 zitiert. Basis der Analyse ist die Befragung von 300 Manager*innen mit Personalverantwortung in kleinen, mittelgroßen und großen deutschen Unternehmen. Dabei zeigen sich zwei Einsatzgebiete der Systeme: Zum einen setzen Personalabteilungen sie ein, um Termine für Bewerbungsgespräche zu koordinieren oder formale Anforderungen in den Unterlagen prüfen, um so den Kreis der Kandidat*innen zu definieren. Das sind alles Routinearbeiten im Vorfeld, hier übernimmt die Künstliche Intelligenz eine Reihe von Prozessen, die den Menschen viel Zeit kosten.
Magazin zu KI-Gestaltungen und -Erfahrungen
„TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis“ nennt sich ein Open Access-Zeitschriftenprojekt des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS). Es erscheint beim Oekom-Verlag, der PDF-Zugriff ist gratis. Die Ausgabe 30, erschienen Ende 2021, widmet sich dem Thema „KI-Systeme gestalten und erfahren“ – ein Titel, der impliziert, dass es Menschen sind, die bei der Entwicklung der KI-Systeme die Gestaltungsrolle übernehmen. In ihren Texten betrachten die Autor*innen u.a. die juristischen oder demokratietheoretischen Rahmenbedingungen von KI sowie die Frage, wie sich solche Systeme in Hinblick auf Akzeptanz und Vertrauen mitarbeiterfreundlich implementieren lassen.
Der positive Effekt: Die HR-Spezialisten können sich auf ihre wahre Arbeit fokussieren. Kein „snake oil“, sondern echte Hilfe. Doch die Befragten nannten noch ein weiteres Einsatzfeld für die KI im Bereich des Recruiting: Sie könne auch dafür genutzt werden, auf Basis einer passenden Datenbasis zu entscheiden, ob jemand anhand der fachlichen Skills für den Job geeignet sei – und zwar unabhängig von den sonstigen Merkmalen dieser Person. „Die Entscheidung richtet sich dann zum Beispiel nicht danach, ob es sich bei dem Bewerber um einen Mann oder eine Frau handelt“, so Hennige in der Pressemeldung. Seine Schlussfolgerung: „KI soll Bewerbungsverfahren bestenfalls auch fairer machen. Denn: Menschen sind nicht immer vorurteilsfrei.“ Das stimmt. Der Haken an der Sache ist nur: Das stimmt dann aber auch für die Künstliche Intelligenz. Schließlich wird sie von den vorurteilsbehafteten Menschen gestaltet.
KI in der Industrie: Muster erkennen
Ein Blick in die industrielle Praxis zeigt, wo Künstliche Intelligenz aktuell in den großen deutschen Unternehmen zum Einsatz kommt. Siemens vermeldet in einem Pressetext, die KI gestalte die Produktion in der Industrie „effizienter, flexibler und zuverlässiger“. Konkrete Anwendungen seien „Spracherkennung zum Bearbeiten einfacher Aufträge, das Erfassen von Umgebungen mittels Kameras, Laser- oder Röntgenstrahlen bis hin zu virtuellen persönlichen Assistenten in der Logistik“, heißt es in der Meldung zu den industriellen Anwendungsfeldern der KI. Ihre Stärke spielten die Systeme dann aus, wenn es um die Analyse der digitalen Informationen gehe, die im Zuge der Industrie 4.0 anfielen: „In den Datenmengen einer Fabrik können mittels intelligenter Softwarelösungen Trends und Muster erkannt werden, die dabei helfen, effizienter oder energiesparender zu fertigen“, heißt es bei Siemens. „Mit steigender Vernetzung kann die KI-Software lernen, auch ‚zwischen den Zeilen‘ zu lesen. Dadurch lassen sich viele komplexe Zusammenhänge in Systemen aufdecken, die der Mensch noch nicht oder nicht mehr überblicken kann.“
Bosch stellt in einer Story auf der Konzernhomepage die KI-Perspektiven in seinen weltweit 240 Werken vor, in denen vernetzte Produktionssysteme im Einsatz sind. Hier entstehen „KI-basierte Regelkreise, die sich selbst regulieren oder optimieren und ganz nebenbei auch noch eine Liste möglicher Problemursachen bereitstellen“, heißt es. Die Vorteile sieht Bosch darin, dass diese Modelle in der Lage seien, „Fehler zu erkennen und zu vermeiden, die Menschen oder herkömmliche Systeme nur schwer wahrnehmen können.“ Die Künstliche Intelligenz werde den Unternehmen darüber hinaus ermöglichen, „ihre Produkte ohne aufwändigere Prozesse deutlich stärker zu individualisieren“ sowie dazu beizutragen, „Roboter in bisher undenkbaren Bereichen zu etablieren“, indem die KI hier dafür sorge, dass sich der Lernaufwand für Roboter reduziere, deren „Sehvermögen“ verbessere und ein „Transferlernen“ zwischen Robotern ermögliche.
Auf dem Weg zur nachhaltigen Lieferkette
Die Fallbeispiele aus der industriellen Praxis zeigen: Zum Einsatz kommt Künstliche Intelligenz in den Unternehmen vor allem dort, wo die Menge und Tiefe an Informationen das menschliche Gehirn komplett überfordert.
Bei Audi setzt man laut Pressmeldung aus dem Sommer 2021 darauf, KI-Methoden für einen besonders komplexen Bereich einzusetzen: den Einblick in die Lieferkette in der Automobilproduktion. Gerade diese Komplexität sorge dafür, dass es wichtig sei, „mögliche Risiken zu verstehen und Zusammenhänge frühzeitig herzustellen“, heißt es in der Pressemeldung. Im Herbst 2020 startete Audi ein Pilotprojekt: In weltweit rund 150 Ländern analysieren intelligente Algorithmen Nachrichten über Lieferant*innen aus online zugänglichen öffentlichen Medien und sozialen Netzwerken. „Geprüft werden Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltverschmutzung, Menschenrechtsverstöße und Korruption. Besteht der Verdacht auf potenzielle Nachhaltigkeitsverstöße, schlägt die Künstliche Intelligenz Alarm“, heißt es in der Pressemeldung. Entwickelt wurde die dafür eingesetzte KI vom österreichischen Start-up Prewave. „Machine Learning und automatisierte Sprachverarbeitung machen so möglich, was manuell ein Ding der Unmöglichkeit wäre: kontinuierliche Risikoabschätzungen über die gesamte Lieferkette hinweg, mit denen die Beschaffung dann proaktiv auf die Lieferant*innen zugehen kann“, wird Harald Nitschinger, CEO von Prewave, in der Audi-Pressemeldung zitiert.
Wie wirken sich KI-Technologien auf die Wissenschaften aus?
Dieser Frage widmet sich jetzt ein deutsch-österreichisches Forschungsteam. Die VolkswagenStiftung fördert das neue Projekt im Rahmen der Initiative „Künstliche Intelligenz“. Bislang hat keine interdisziplinäre und vergleichende Studie den Einsatz von maschinellen Lernverfahren in verschiedenen Wissenschaftsfeldern untersucht und dabei sowohl informatische, historische wie auch ethnographische Perspektiven berücksichtigt, so die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bonn, der Universität Wien und des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Team analysiert konkrete „Fokus-Projekte“ in unterschiedlichen Disziplinen, die das Spektrum von Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften abdecken. Es soll untersucht werden, wie mit KI-Verfahren in unterschiedlichen Disziplinen geforscht wird. Die Forschenden haben dabei die Potenziale, aber auch die Grenzen, Risiken und Ambivalenzen von KI-basierten Methoden im Blick.
Die Fallbeispiele aus der industriellen Praxis zeigen: Zum Einsatz kommt Künstliche Intelligenz in den Unternehmen vor allem dort, wo die Menge und Tiefe an Informationen das menschliche Gehirn komplett überfordert. Welche dieser Daten relevant sind und welche nicht – diese Regeln gibt weiterhin der Mensch vor. Das muss er auch, denn eine KI weiß von sich aus nichts über Menschenrechte oder das Fehlverhalten der Korruption. Daraus folgen zwei Dinge: Erstens bleibt der Mensch das bestimmende Element, zweitens bringt er damit weiterhin seine moralischen Vorstellungen, aber auch Vorurteile ins Spiel. Darauf zu bauen, die KI könnte sich aus eigener Motivation heraus zu einer fairen, gerechten oder sogar moralischen Instanz entwickeln, ist der Glaube ans „snake oil“.
Menschen machen Maschinen
Was die KI-Systeme aber durchaus leisten können: Prozesse in Gang zu setzen, die den Menschen dabei helfen, unfaire und ungerechte Strukturen offensichtlich zu machen. Und zwar auch in einem Bereich wie dem Recruiting, wo die KI fehlende Diversity erkennbar machen kann. „Entscheidend ist dabei ein Verständnis der verschiedenen ‚Superkompetenzen‘ von Mensch und Maschine“, schreiben die Trendforscher*innen vom Zukunftsinstitut in ihrem „Trendausblick 2022“. „Computer sind unschlagbar im Rechnen und in der Mustererkennung, doch nur Menschen können denken, fühlen, Kontexte erfassen und kreativ schöpferisch sein.“ Die eigentliche Zukunftsbestimmung intelligenter Technologien werde deshalb darin bestehen, die Erschließung dieser genuin menschlichen Potenziale zu unterstützen. Kurz: Der Job der Künstlichen Intelligenz sollte es sein, dem denkenden Menschen Aufwind zu geben.




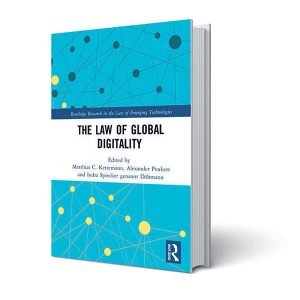





 Fabian Michl:
Fabian Michl: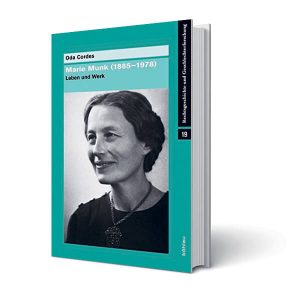 Oda Cordes:
Oda Cordes: Oda Cordes:
Oda Cordes:
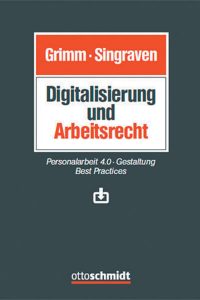 Der „Grimm/Singraven, Digitalisierung und Arbeitsrecht“ beinhaltet die wichtigsten Trends der digitalen Transformation im Personalbereich – praxiserprobte Formulare, Muster und Vertragsklauseln zu jedem Komplex inklusive. Insgesamt behandelt das Werk in 29 Kapiteln alle wichtigen Trends, die sich im Zuge der digitalen Transformation für den Personalbereich ergeben. Ausgangspunkt ist dabei jeweils ein Sachproblem, in der Regel eine Umsetzungsherausforderung der Personalabteilung, und keine Rechtsfrage. Dr. Detlef Grimm, Dr. Jonas Singraven: Digitalisierung und Arbeitsrecht. Otto Schmidt 2022, 99 Euro.
Der „Grimm/Singraven, Digitalisierung und Arbeitsrecht“ beinhaltet die wichtigsten Trends der digitalen Transformation im Personalbereich – praxiserprobte Formulare, Muster und Vertragsklauseln zu jedem Komplex inklusive. Insgesamt behandelt das Werk in 29 Kapiteln alle wichtigen Trends, die sich im Zuge der digitalen Transformation für den Personalbereich ergeben. Ausgangspunkt ist dabei jeweils ein Sachproblem, in der Regel eine Umsetzungsherausforderung der Personalabteilung, und keine Rechtsfrage. Dr. Detlef Grimm, Dr. Jonas Singraven: Digitalisierung und Arbeitsrecht. Otto Schmidt 2022, 99 Euro.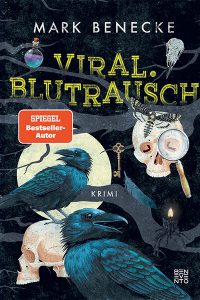 Eine Mordserie erschüttert eine deutsche Großstadt. Leichen von jungen Frauen tauchen an unterschiedlichen Fundorten auf. Der Gerichtsmediziner macht eine grausige Feststellung: Den Frauen wurden mit chirurgischer Genauigkeit große Mengen Blut abgenommen. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer steckt hinter den Schneewittchen-Morden? Hauptkommissarin Christine Peterson fordert die Unterstützung der Privatermittler Janina Funke und Bastian Becker an. Doch die Spurensuche erweist sich als schleppend. Je länger die Mordermittlungen andauern, desto mehr Verschwörungsmärchen verbreiten sich im Netz. Nach und nach entwickeln sie sich zu einer ganz eigenen, echten Bedrohung. Mark Benecke: Viral. Blutrausch. Benevento 2022, 20 Euro.
Eine Mordserie erschüttert eine deutsche Großstadt. Leichen von jungen Frauen tauchen an unterschiedlichen Fundorten auf. Der Gerichtsmediziner macht eine grausige Feststellung: Den Frauen wurden mit chirurgischer Genauigkeit große Mengen Blut abgenommen. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer steckt hinter den Schneewittchen-Morden? Hauptkommissarin Christine Peterson fordert die Unterstützung der Privatermittler Janina Funke und Bastian Becker an. Doch die Spurensuche erweist sich als schleppend. Je länger die Mordermittlungen andauern, desto mehr Verschwörungsmärchen verbreiten sich im Netz. Nach und nach entwickeln sie sich zu einer ganz eigenen, echten Bedrohung. Mark Benecke: Viral. Blutrausch. Benevento 2022, 20 Euro.
 Die wahre Reaktion eines Menschen spiegelt sich nicht in seinen Worten wider. Ein leichtes Stirnrunzeln, das Meiden von Blickkontakt oder Streichen durch die Haare sind das wahre Spiegelbild unseres Inneren. Nonverbale Botschaften werden immer an unser Gegenüber gesendet, ob wir wollen oder nicht . Die Haltung, Gestik und Mimik spielen dabei eine Schlüsselrolle. Das, was wir unserem Gegenüber sagen und das, was wir mit unserer Mimik und Gestik vermitteln, ist oftmals ein unterschiedliches Paar Schuhe. Noch bevor wir das erste Wort mit einer Person gewechselt haben, konnten wir uns bereits ein Bild von ihr machen. Die Gangart, Körperhaltung und Kleidung bestimmen maßgeblich, wie wir auf Menschen wirken und welchen Eindruck wir hinterlassen. Johannes Lichtenberg: Entschlüsselt! Körpersprache & Menschen lesen wie ein Buch. KR Publishing 2021, 12,90 Euro.
Die wahre Reaktion eines Menschen spiegelt sich nicht in seinen Worten wider. Ein leichtes Stirnrunzeln, das Meiden von Blickkontakt oder Streichen durch die Haare sind das wahre Spiegelbild unseres Inneren. Nonverbale Botschaften werden immer an unser Gegenüber gesendet, ob wir wollen oder nicht . Die Haltung, Gestik und Mimik spielen dabei eine Schlüsselrolle. Das, was wir unserem Gegenüber sagen und das, was wir mit unserer Mimik und Gestik vermitteln, ist oftmals ein unterschiedliches Paar Schuhe. Noch bevor wir das erste Wort mit einer Person gewechselt haben, konnten wir uns bereits ein Bild von ihr machen. Die Gangart, Körperhaltung und Kleidung bestimmen maßgeblich, wie wir auf Menschen wirken und welchen Eindruck wir hinterlassen. Johannes Lichtenberg: Entschlüsselt! Körpersprache & Menschen lesen wie ein Buch. KR Publishing 2021, 12,90 Euro.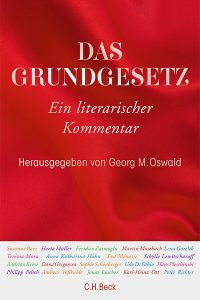 Das Grundgesetz ist gerade in Krisenzeiten die Grundlage jedes gesellschaftspolitischen Diskurses in Deutschland. Höchste Zeit also für einen Kommentar, der die Verfassung für unsere Zeit neu erklärt, anhand von Erzählungen und Erfahrungen, juristisch abwägend und gerne auch schräg von außen blickend. Das Ergebnis ist ein „Grundgesetz-Kommentar für alle“ voller überraschender Einblicke, treffender Geschichten und funkelnder Essays. Georg M. Oswald (Hrsg.): Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar. C.H.Beck 2022, 26 Euro
Das Grundgesetz ist gerade in Krisenzeiten die Grundlage jedes gesellschaftspolitischen Diskurses in Deutschland. Höchste Zeit also für einen Kommentar, der die Verfassung für unsere Zeit neu erklärt, anhand von Erzählungen und Erfahrungen, juristisch abwägend und gerne auch schräg von außen blickend. Das Ergebnis ist ein „Grundgesetz-Kommentar für alle“ voller überraschender Einblicke, treffender Geschichten und funkelnder Essays. Georg M. Oswald (Hrsg.): Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar. C.H.Beck 2022, 26 Euro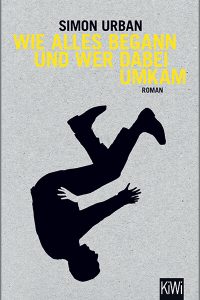 Wo endet ein inselbegabter Jurastudent, der an den starren Regelwerken des Gesetzes verzweifelt und beschließt, das Recht selbst in die Hand zu nehmen? In einer Gefängniszelle! Was aber zwischendurch geschieht, ist so unglaublich und derart gnadenlos und witzig erzählt, dass einem die Luft wegbleibt. Bereits als Kind findet der Held dieses Romans zur Juristerei: Er bereitet ein Verfahren gegen seine Großmutter vor, den Drachen der Familie – und verurteilt sie im Wohnzimmer in Abwesenheit zum Tode. Berufung: nicht möglich. Dass ein Jurastudium im beschaulichen Freiburg einem solchen Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell. Auch hier kann er die Finger nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die eigene Hand. Simon Urban gehört zu den großen, mutigen Erzähltalenten seiner Generation. In seinem neuen Roman entfesselt er eine furiose Geschichte um einen Außenseiter, der zum dunklen Rächer wird. Und der zuvor auszieht, um sich auf einer weltweiten Recherchereise am Unrecht und Recht der Welt zu schulen. Simon Urban: Wie alles begann und wer dabei umkam. KiWi Taschenbuch 2022, 14 Euro.
Wo endet ein inselbegabter Jurastudent, der an den starren Regelwerken des Gesetzes verzweifelt und beschließt, das Recht selbst in die Hand zu nehmen? In einer Gefängniszelle! Was aber zwischendurch geschieht, ist so unglaublich und derart gnadenlos und witzig erzählt, dass einem die Luft wegbleibt. Bereits als Kind findet der Held dieses Romans zur Juristerei: Er bereitet ein Verfahren gegen seine Großmutter vor, den Drachen der Familie – und verurteilt sie im Wohnzimmer in Abwesenheit zum Tode. Berufung: nicht möglich. Dass ein Jurastudium im beschaulichen Freiburg einem solchen Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell. Auch hier kann er die Finger nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die eigene Hand. Simon Urban gehört zu den großen, mutigen Erzähltalenten seiner Generation. In seinem neuen Roman entfesselt er eine furiose Geschichte um einen Außenseiter, der zum dunklen Rächer wird. Und der zuvor auszieht, um sich auf einer weltweiten Recherchereise am Unrecht und Recht der Welt zu schulen. Simon Urban: Wie alles begann und wer dabei umkam. KiWi Taschenbuch 2022, 14 Euro.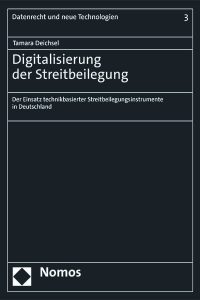 Gegenstand des Werkes ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die Digitalisierung der deutschen Streitbeilegungslandschaft, wobei die staatliche Ziviljustiz, die außergerichtliche Streitschlichtung und die Streitbeilegungsverfahren im Online-Handel betrachtet werden. Aus einer übergreifenden Perspektive wird untersucht, wie durch den Einsatz von technischen Instrumenten die Streitbeilegung in Deutschland moderner und wieder attraktiver werden könnte. Mit dem Einsatz von technischen Werkzeugen in den verschiedenen Verfahrensetappen einer jeden Streitbeilegung soll nicht nur der Zugang zur Streitbeilegung erleichtert und vereinfacht, sondern ebenso aufgezeigt werden, wie dadurch eine effektive, schnelle und ressourcenschonende Streitbeilegung geschaffen werden könnte. Dr. Tamara Deichsel: Digitalisierung der Streitbeilegung. Nomos 2022, 112 Euro.
Gegenstand des Werkes ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die Digitalisierung der deutschen Streitbeilegungslandschaft, wobei die staatliche Ziviljustiz, die außergerichtliche Streitschlichtung und die Streitbeilegungsverfahren im Online-Handel betrachtet werden. Aus einer übergreifenden Perspektive wird untersucht, wie durch den Einsatz von technischen Instrumenten die Streitbeilegung in Deutschland moderner und wieder attraktiver werden könnte. Mit dem Einsatz von technischen Werkzeugen in den verschiedenen Verfahrensetappen einer jeden Streitbeilegung soll nicht nur der Zugang zur Streitbeilegung erleichtert und vereinfacht, sondern ebenso aufgezeigt werden, wie dadurch eine effektive, schnelle und ressourcenschonende Streitbeilegung geschaffen werden könnte. Dr. Tamara Deichsel: Digitalisierung der Streitbeilegung. Nomos 2022, 112 Euro.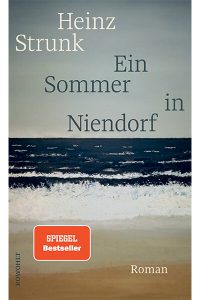 Das neue Buch von Heinz Strunk erzählt eine Art norddeutsches „Tod in Venedig“, nur sind die Verlockungen weniger feiner Art als seinerzeit beim Kollegen aus Lübeck. Ein bürgerlicher Held, ein Jurist und Schriftsteller namens Roth, begibt sich für eine längere Auszeit nach Niendorf: Er will ein wichtiges Buch schreiben, eine Abrechnung mit seiner Familie. Am mit Bedacht gewählten Ort – im kleinbürgerlichen Ostseebad wird er seinesgleichen nicht so leicht über den Weg laufen – gerät aber bald in die Fänge eines trotz seiner penetranten Banalität dämonischen Geists: ein Strandkorbverleiher. Der Mann ist außerdem Besitzer des örtlichen Spirituosengeschäfts. Aus Befremden und Belästigtsein wird nach und nach Zufallsgemeinschaft und irgendwann Notwendigkeit. Als Dritte stößt die Freundin des Schnapshändlers hinzu, in jeder Hinsicht eine Nicht-Traumfrau – eigentlich. Und am Ende dieser Sommergeschichte ist Roth seiner alten Welt komplett abhandengekommen, ist er ein ganz anderer. Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf. Rowohlt 2022, 22 Euro.
Das neue Buch von Heinz Strunk erzählt eine Art norddeutsches „Tod in Venedig“, nur sind die Verlockungen weniger feiner Art als seinerzeit beim Kollegen aus Lübeck. Ein bürgerlicher Held, ein Jurist und Schriftsteller namens Roth, begibt sich für eine längere Auszeit nach Niendorf: Er will ein wichtiges Buch schreiben, eine Abrechnung mit seiner Familie. Am mit Bedacht gewählten Ort – im kleinbürgerlichen Ostseebad wird er seinesgleichen nicht so leicht über den Weg laufen – gerät aber bald in die Fänge eines trotz seiner penetranten Banalität dämonischen Geists: ein Strandkorbverleiher. Der Mann ist außerdem Besitzer des örtlichen Spirituosengeschäfts. Aus Befremden und Belästigtsein wird nach und nach Zufallsgemeinschaft und irgendwann Notwendigkeit. Als Dritte stößt die Freundin des Schnapshändlers hinzu, in jeder Hinsicht eine Nicht-Traumfrau – eigentlich. Und am Ende dieser Sommergeschichte ist Roth seiner alten Welt komplett abhandengekommen, ist er ein ganz anderer. Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf. Rowohlt 2022, 22 Euro.
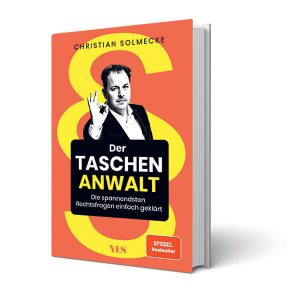

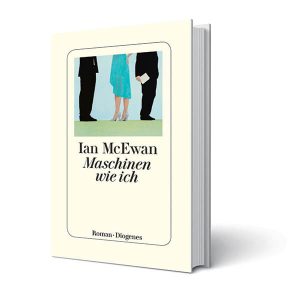 Ian McEwan imaginiert in diesem kühnen Roman die Vergangenheit neu: In einer Welt, die ein wenig anders ist als die unsere, stellt ein Roboter ein junges Liebespaar vor ein gefährliches Dilemma. London, 1982: Großbritannien hat gerade den Falkland-Krieg verloren, und dank der Forschung von Alan Turing gibt es Anfang der achtziger Jahre schon Internet, Handys und selbstfahrende Autos – und die ersten täuschend echten künstlichen Menschen. Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30, ist seit seiner Kindheit von Künstlicher Intelligenz fasziniert, Alan Turing ist sein Idol. Auch wenn es ihn ein kleines Vermögen kostet, kauft er sich sofort einen der ersten Androiden, die auf den Markt kommen. Charlie wünscht sich einen Freund, einen Helfer, einen interessanten Gesprächspartner. Er erhält viel mehr als das: einen Rivalen um die Liebe der schönen Miranda und eine moralische Herausforderung, die ihn bis zum Äußersten reizt. Ian McEwan: Maschinen wie ich. Diogenes 2019. ISBN 978-3-257-60958-5. 11,99 Euro.
Ian McEwan imaginiert in diesem kühnen Roman die Vergangenheit neu: In einer Welt, die ein wenig anders ist als die unsere, stellt ein Roboter ein junges Liebespaar vor ein gefährliches Dilemma. London, 1982: Großbritannien hat gerade den Falkland-Krieg verloren, und dank der Forschung von Alan Turing gibt es Anfang der achtziger Jahre schon Internet, Handys und selbstfahrende Autos – und die ersten täuschend echten künstlichen Menschen. Charlie, ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30, ist seit seiner Kindheit von Künstlicher Intelligenz fasziniert, Alan Turing ist sein Idol. Auch wenn es ihn ein kleines Vermögen kostet, kauft er sich sofort einen der ersten Androiden, die auf den Markt kommen. Charlie wünscht sich einen Freund, einen Helfer, einen interessanten Gesprächspartner. Er erhält viel mehr als das: einen Rivalen um die Liebe der schönen Miranda und eine moralische Herausforderung, die ihn bis zum Äußersten reizt. Ian McEwan: Maschinen wie ich. Diogenes 2019. ISBN 978-3-257-60958-5. 11,99 Euro.


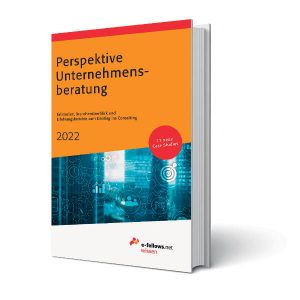 Das Handbuch „Perspektive Unternehmensberatung 2022: Case Studies, Branchenüberblick und Erfahrungsberichte zum Einstieg ins Consulting“ bietet dem Nachwuchs einen ersten Überblick über Themen und Fragen der Beratung. Das Buch beinhaltet eine Reihe von Case- Studies und widmet sich den Fragen: Welche Beratungsbereiche und Player gibt es? Mit welchen Einstiegsgehältern kann man rechnen? Was sollte man bei der Bewerbung beachten? Wie bereitet man sich am besten auf das Auswahlverfahren und die Case Studies vor? Das Buch ist sowohl in gedruckter Form als auch als E-Book erhältlich. Perspektive Unternehmensberatung 2022: Case Studies, Branchenüberblick und Erfahrungsberichte zum Einstieg ins Consulting. e-fellows.net 2021, 19,90 Euro
Das Handbuch „Perspektive Unternehmensberatung 2022: Case Studies, Branchenüberblick und Erfahrungsberichte zum Einstieg ins Consulting“ bietet dem Nachwuchs einen ersten Überblick über Themen und Fragen der Beratung. Das Buch beinhaltet eine Reihe von Case- Studies und widmet sich den Fragen: Welche Beratungsbereiche und Player gibt es? Mit welchen Einstiegsgehältern kann man rechnen? Was sollte man bei der Bewerbung beachten? Wie bereitet man sich am besten auf das Auswahlverfahren und die Case Studies vor? Das Buch ist sowohl in gedruckter Form als auch als E-Book erhältlich. Perspektive Unternehmensberatung 2022: Case Studies, Branchenüberblick und Erfahrungsberichte zum Einstieg ins Consulting. e-fellows.net 2021, 19,90 Euro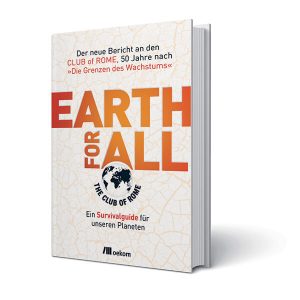 1972 erschütterte ein Buch die Fortschrittsgläubigkeit der Welt: „Die Grenzen des Wachstums“. Der erste Bericht an den Club of Rome gilt seither als die einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Zum 50-jährigen Jubiläum blicken renommierte Wissenschaftler*innen wie Jørgen Randers, Sandrine Dixson-Declève und Johan Rockström abermals in die Zukunft – und legen ein Genesungsprogramm für unsere krisengeschüttelte Welt vor. Um den trägen „Tanker Erde“ von seinem zerstörerischen Kurs abzubringen, verbinden sie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen Ideen für eine andere Wirtschaft. Der aktuelle Bericht an den Club of Rome liefert eine politische Gebrauchsanweisung für die wesentlichen Handlungsfelder, in denen mit vergleichbar kleinen Weichenstellungen große Veränderungen erreicht werden können. Club of Rome (Hrsg.): Earth for All. Ein Survivalguide für unseren Planeten. Der neue Bericht an den Club of Rome, 50 Jahre nach „Die Grenzen des Wachstums“. Oekom 2022. 25,00 Euro.
1972 erschütterte ein Buch die Fortschrittsgläubigkeit der Welt: „Die Grenzen des Wachstums“. Der erste Bericht an den Club of Rome gilt seither als die einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Zum 50-jährigen Jubiläum blicken renommierte Wissenschaftler*innen wie Jørgen Randers, Sandrine Dixson-Declève und Johan Rockström abermals in die Zukunft – und legen ein Genesungsprogramm für unsere krisengeschüttelte Welt vor. Um den trägen „Tanker Erde“ von seinem zerstörerischen Kurs abzubringen, verbinden sie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen Ideen für eine andere Wirtschaft. Der aktuelle Bericht an den Club of Rome liefert eine politische Gebrauchsanweisung für die wesentlichen Handlungsfelder, in denen mit vergleichbar kleinen Weichenstellungen große Veränderungen erreicht werden können. Club of Rome (Hrsg.): Earth for All. Ein Survivalguide für unseren Planeten. Der neue Bericht an den Club of Rome, 50 Jahre nach „Die Grenzen des Wachstums“. Oekom 2022. 25,00 Euro.