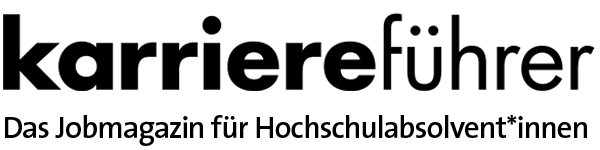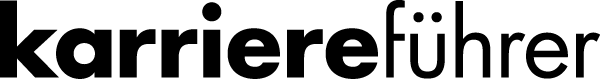Versicherungen haben es im Gegensatz zu anderen Bereichen in der Finanzwirtschaft geschafft, ohne nennenswerte Verluste durch die letzten Jahre zu kommen. Sie hielten nicht nur das Beschäftigungsniveau, sondern haben sogar die Sorge: Wo bekommen wir ausreichend Fachkräfte für die Zukunft her? Von Christoph Berger
Gute Noten, einen Masterabschluss und Praxiserfahrung im Versicherungsbereich: Dominique Zeh brachte zu ihrem Berufsstart bei der Allianz alles mit, was sich ihr Arbeitgeber erhoffte und was die Wunschanforderungen vieler Versicherer sind. Bereits während ihres Studiums hatte die heute 29-jährige Betriebswirtin begonnen, Kontakte zu Deutschlands größtem Versicherer zu knüpfen. Erst arbeitete sie als Werkstudentin in dem Unternehmen, später schrieb sie dort ihre Masterarbeit zum Thema Marktmanagement im Bereich Alternative Vertriebswege. Darin analysierte sie die Vertriebsstrukturen von Versicherungen und arbeitete alternative Wege des Verkaufs von Finanzdienstleistungsprodukten heraus. „Nach dieser strategischen Arbeit wollte ich das operative Geschäft eines Versicherungsunternehmens kennenlernen. Deshalb habe ich mich um eine der Traineestellen beworben“, sagt sie. Ein Jahr lang lernt sie nun die unterschiedlichen Personenversicherungsbereiche des Unternehmens kennen – also die Sparten Leben und Kranken. Gerade hat sie zehn Wochen Schulung zum Thema betriebliche Altersversorgung hinter sich. Im ersten Jahr des Traineeprogramms sind auch einige Stationen im Vertrieb vorgesehen. Im zweiten Jahr sind Stationen geplant, die sie auf ihre weitere Laufbahn vorbereiten. Zum Ende wird sie eine Projektarbeit durchführen. Dominique Zeh hat sich für ihren Berufseinstieg eine Branche ausgesucht, die zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland zählt. Die Versicherungswirtschaft wird im Umsatzvergleich mit anderen Branchen nur vom Maschinenbau und der Chemischen Industrie überflügelt. Laut dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2011, das vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft herausgegeben wird, arbeiten in und für die 582 Versicherungsunternehmen in Deutschland 561.600 Menschen. 53 Prozent von ihnen sind abhängig beschäftigt, 47 Prozent selbstständige Versicherungsvermittler und -berater. Die meisten Versicherer haben sich auf Schaden und Unfall spezialisiert. Es folgen die Pensionskassen, Lebensversicherungen, Krankenkassen und Rückversicherer. Legt man das Prämienaufkommen zugrunde, ist Deutschland im Segment der Rückversicherung der führende Standort weltweit, eines der größten Unternehmen ist die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, bekannt unter der Marke Munich Re. Dort arbeitet seit 2010 die Mathematikerin und Geowissenschaftlerin Linda Gleser. In der Abteilung Global Clients/North America ist die 28-Jährige zuständig für die Risikomodellierung von Sachversicherungen im nordamerikanischen Markt. Ihre Kunden sind zumeist Erstversicherer, die sich mögliche Schäden ihrer Klientel absichern lassen wollen. Gleser schätzt anhand stochastischer Modelle zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, mit der Industrieanlagen in verschiedenen Regionen von Naturkatastrophen getroffen werden. „Die Berechnung von Naturkatastrophen- Risiken besteht vor allem in der Plausibilisierung, zu der eine intensive Auswertung eigener Daten und Ergebnisse gehört“, erklärt sie. Neben den Modellen nutzt Gleser aber auch Satellitenbilder, weitere Experteneinschätzungen und Datenmaterial. Auf der Grundlage ihrer Ergebnisse wird schließlich für jeden Versicherungsbestand, der rückversichert werden soll, entschieden, zu welchen Bedingungen das passieren kann und was dafür der risikoadäquate Preis ist. Beides fließt in den Vertrag mit dem Kunden ein, den ein Underwriter zeichnet. Der Rückversicherer übernimmt bei Naturkatastrophendeckungen oft das Spitzenrisiko aus dem Bestand des Erstversicherers und sorgt durch seine Internationalität für geografische Streuung der Risiken. Immer behält der Risikomodellierer dabei die Grenzen des eigenen Risikoappetits im Auge. „Unsere Modelle dienen auch der Kontrolle unseres gesamten Versicherungsbestandes“, sagt sie. „Das heißt, dass wir in besonders gefährdeten Regionen Haftungen deckeln; das Risiko kann ansonsten auch für den Rückversicherer zu hoch werden.“ Schon etwas länger in der Versicherungsbranche ist die 31-jährige Nicole Heidemeyer. Nachdem sie Ende 2006 bei der Generali Deutschland Gruppe ein zwölfmonatiges Traineeprogramm begonnen und durchlaufen hat – inzwischen wurde es auf 18 Monate ausgeweitet –, arbeitete sie im Personalmanagement des Unternehmens. Dort baute sie das strategische Personalmarketing auf. „Der Reiz lag für mich darin, mitzugestalten und gemeinsam mit Mitarbeitern der unterschiedlichen Konzernunternehmen eine Strategie für den Auftritt der Generali Deutschland im Bewerbermarkt zu entwickeln“, erinnert sie sich an ihr erstes Projekt. Schon während ihres Traineeprogramms konnte sie von dem großen Unternehmensverbund und der Markenvielfalt des Unternehmens profitieren, verschiedene Tätigkeitsfelder bei unterschiedlichen Konzernunternehmen kennenlernen. So wurde sie auf eine zukünftige Führungsaufgabe im Konzern Schritt für Schritt vorbereitet. Seit einem halben Jahr leitet sie nun die Gruppe Projekte im Projekt-und Anforderungsmanagement der Generali Deutschland Schadenmanagement, einer internen Dienstleistungsgesellschaft des Konzerns. „Unser Betätigungsfeld sind die aus der jährlichen Maßnahmenplanung abgeleiteten IT-Projekte zur Erweiterung und Optimierung der Anwendungslandschaft im Schadenmanagement“, erklärt sie. Zu ihren Aufgaben gehört dabei nicht nur, die Projekte mit ihrem Team abzuwickeln und zu begleiten. Sie muss auch die Schnittstellenfunktion zwischen IT und Fachbereich sicherstellen und dafür sorgen, dass die fachlichen Anforderungen in den IT-Systemen abgebildet werden. Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und auf Fakten basierende Überzeugungsarbeit sind dafür extrem wichtig. Fragt man die drei Versicherungsexpertinnen nach ihren Motivationen und den Gründen dafür, warum sie sich die Versicherungsbranche für ihren Karrierestart ausgesucht haben, sind die Antworten ähnlich: „Auch wenn es nach außen hin nicht immer den Anschein macht: Die Versicherungsbranche ist eine spannende und interessante Branche.“ Das beginne schon bei der Vielfalt im Mitarbeiterstamm. Fast sämtliche Berufsgruppen sind in einem Versicherungsunternehmen vertreten: vom Betriebswirt über den Informatiker und Ingenieur, vom Zahnarzt und Juristen bis hin zum Kunsthistoriker – dieser Mix macht die Arbeit nach Ansicht der drei äußerst interessant. Hinzu kommt, dass die Branche ständigen Veränderungen und Anpassungen unterworfen ist – hervorgerufen durch rechtliche Vorgaben, den technischen Fortschritt sowie durch soziale und gesellschaftliche Entwicklungen. Die Unternehmen müssen zum einen reagieren, zum anderen vordenken. Dies mache sie innovativ, ständig sei man dabei, Lösungen zu suchen und zu entwickeln. Nicht nur die drei Einsteigerinnen sind sich bezüglich der Attraktivität der Branche einig, sondern auch die Personalverantwortlichen, wenn es um das Anforderungsprofil von Absolventen geht. An erster Stelle steht dabei der zu Beginn erwähnte sehr gute Notendurchschnitt im Studium. Dominik Hahn, Personalreferent im Personalmarketing bei der Allianz, sagt: „Für unsere Einstiegsprogramme suchen wir die 10 bis 15 Prozent der Besten.“ Wer in das Vorstandsassistentenprogramm aufgenommen werden will, sollte außerdem einen MBA oder die Promotion in der Tasche haben. Verena König, Personalverantwortliche bei Munich Re, fügt hinzu: „Wir suchen außerdem Absolventen international ausgerichteter Studiengänge und erwarten sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, Praktikums- und Auslandserfahrungen.“ Dafür wird einiges geboten: Neben einer intensiven Betreuung, einem gegenüber anderen Branchen überdurchschnittlichen Gehalt und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten weiten die Unternehmen ihr Angebot aus. Christoph Zeckra, Leiter Konzernpersonal bei der Generali Deutschland, sagt: „Die Vereinbarkeit von Karriere und Familie wird durch unterschiedliche Familien- und Betreuungsangebote und flexible Arbeitszeitmodelle auch für Führungskräfte besonders gefördert.“Interview mit Andreas Schmitz
Begonnen hat Andreas Schmitz seine Banker-Karriere bei HSBC Trinkaus vor 23 Jahren als Assistent eines persönlich haftenden Gesellschafters. Heute ist er Sprecher des Vorstandes und zudem Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken. Im Interview erzählt der 52-Jährige über seinen Weg nach oben und die Anforderungen, auf die Einsteiger heute in der Bankenbranche treffen. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Andreas Schmitz, Jahrgang 1960, beendete sein Studium der Volkswirtschaft und der Rechtswissenschaften an der Universität Bonn nach Abschluss des zweiten Staatsexamens als Rechtsanwalt. Seine berufliche Laufbahn bei HSBC Trinkaus begann er als Assistent eines der persönlich haftenden Gesellschafter. Anschließend arbeitete er im Firmenkundengeschäft und baute später die Investmentbanking-Aktivitäten der Bank auf. 2002 wurde Andreas Schmitz persönlich haftender Gesellschafter der Bank, 2004 zum Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter berufen und mit dem Rechtsformwechsel 2006 zum Sprecher des Vorstands ernannt. Heute ist er verantwortlich für die Bereiche Global Banking und Investment Banking sowie für das Emissions- und Konsortialgeschäft. Er ist zudem Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Präsident der Börse Düsseldorf, Vizepräsident der IHK Düsseldorf und Mitglied des Verwaltungsrats der KfW sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Andreas Schmitz ist verheiratet und hat drei Kinder.
Zum Unternehmen
HSBC Trinkaus ist eine international aufgestellte, kundenorientierte Geschäftsbank. Das Haus versteht sich als Bank, die zum einen als Tochter der britischen Mutterbank HSBC Teil einer der weltweit größten Bankengruppen ist, zum anderen ihre Kunden individuell und persönlich mit den Werten einer 227-jährigen Geschichte betreut. Das Mutterhaus HSBC hat rund 7200 Niederlassungen in mehr als 80 Ländern und Regionen. Für die deutsche Tochter HSBC Trinkaus sind rund 2500 Mitarbeiter tätig, von denen mehr als ein Drittel länger als zehn Jahre im Unternehmen arbeiten. Das Durchschnittsalter liegt bei 39 Jahren. Der Fokus liegt auf der Beratung von vermögenden Privatkunden sowie Firmen- und institutionellen Kunden. Stammsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Zudem verfügt die Bank über Standorte in Baden-Baden, Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Luxemburg. Mit „AA“ besitzt HSBC Trinkaus das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. [/pull_quote_center]„Hohe Nachfrage im Vertrieb“
Als Recruiting-Spezialistin für die Finanzbranche weiß Daniela Schmidt, wie man für einen erfolgreichen Karriereeinstieg gestrickt sein muss und was dem Nachwuchs wichtig ist, wenn er sich für ein Unternehmen entscheidet. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Daniela Schmidt ist studierte Soziologin und Psychologin und gründete 1995 die Recruiting-Agentur DS Connection. Ihre Spezialgebiete sind Direktsuche, Eignungsdiagnostik und Auswahlverfahren in der Finanzdienstleistungsbranche. Zu ihren Kunden gehören Regionalbanken, Großbanken und Versicherungsgesellschaften. Seit 2005 ist Daniela Schmidt auch in der Organisationsberatung tätig.
karriereführer banken/versicherungen 2012.2013
Titelthema: Sie können es! – Den Wandel gestalten
Fokussiert. Die Finanzbranche befindet sich im Wandel. Die Zocker und Jongleure mag es zwar noch geben, doch die Banken erwarten von ihrem Nachwuchs keine neuen Risikonummern mehr: Sie suchen Absolventen mit einem Verständnis für das, was die Kunden wollen. Diesen Grundsatz wollen sie nicht nur propagieren, sondern leben. Dazu gehören verstärkt langfristige Geldanlagen und ein ungetrübtes Vertrauensverhältnis des Kunden zu Bank und deren Beratern. Mit alten Tugenden zum Erfolg „Hohe Nachfrage im Vertrieb“Top-Interview:
Andreas Schmitz, Vorstandssprecher von HSBC TrinkausSpecial Versicherungen
Mit Sicherheit Karriere machen „Haus der 100 Berufe“Einsteigen
Privatbank versus Großbank Jung und erfolgreich bei: HorbachAufgestiegen
Aufgestiegen zur Associate der UniCredit GroupWeiterbilden
Ahoi, MBAProjekt
Was macht eigentlich ein Aktuar?Sichtweise
Schwester Katharina Rohrmann, früher Bankerin, heute OrdensschwesterService: Aktuelle Firmenporträts für Ihre Bewerbung
AXA Konzern AG Bayerische Landesbank (BayernLB) BERENBERG BANK Deloitte HFH · Hamburger Fern-Hochschule Hannover Rück SE HORBACH Wirtschaftsberatung GmbH ING-DiBa AG Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG R+V Versicherung Steria Mummert Consulting AGPartner
IQB JOBWARE TALENTS – Die JobmesseKomplette Ausgabe
E-Paper karriereführer banken/versicherungen 2012.2013 Download karriereführer banken/versicherungen 2012.2013 (ca. 10 MB)Mit alten Tugenden zum Erfolg
Die Bankbranche sucht nach Einsteigern, die mehr im Blick haben als trockene Zahlen. Ob im Investmentbanking oder im Beratungsgeschäft: Gefragt sind Persönlichkeiten, für die solide Lösungen im Sinne der Kunden wichtiger sind als kurzfristige Erfolge. Von André Boße
Der Banker von heute? Ein Zahlenspezialist muss er immer noch sein. Ohne dieses Know-how geht es nicht. Aber das alleine reicht nicht aus. Der Banker von heute muss mehr können als jeder noch so hyperschnelle Algorithmus, jede noch so intelligent programmierte Software. „Viele meinen, dass sich bei einer Bankkarriere immer noch alles um trockene Zahlen dreht“, sagt Claudia Gutscher, Personaldirektorin der Targobank, und schüttelt dabei mit dem Kopf. Dann definiert sie, was einen Banker von heute wirklich auszeichnet: „Es geht vor allem um den Menschen.“ Seit dem Crash der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 steckt die Bankenbranche in einer ungeheuer heraufordernden Zeit. Das Wort „Krise“ passt schon deshalb nicht, weil Krisen als Zuspitzung zu verstehen und daher eher von kurzer Dauer sind. Krisen bedeuten Einschnitte: weniger Arbeitsplätze, weniger Freiräume, weniger Chancen. Doch die Situation für Hochschulabsolventen gestaltet sich anders. Die Banken sind auf der Suche nach talentierten Nachwuchskräften, weil sie sich von ihnen neue Impulse und neue Ideen für das Geschäft erhoffen. Auf eines legen die Häuser dabei besonderen Wert: Gefragt sind keine Kandidaten, die sich nach der Uni sofort ein Dutzend Anzüge oder Kostüme zulegen, sich den vermeintlich passenden Sprachduktus der Banker draufschaffen und mit dem Ziel ins Vorstellungsgespräch ziehen, dem potenziellen Chef neue Möglichkeiten für riskante Anlagestrategien zu präsentieren. Risikoreich rechnen können Computer nämlich auch. Und zwar wesentlich schneller. Was Computer aber nicht besitzen, sind menschliche Tugenden. Und genau nach diesen sucht die Branche. Weil – und da sind die meisten Häuser ganz ehrlich – es eine Zeit gab, in der klassische Werte im Geschäft eine zu geringe Rolle gespielt haben. Anke Kirn ist bei der Deutschen Bank für die Talentsuche verantwortlich und nennt die Tugenden, auf die es in ihrem Unternehmen ankommt: „Höflichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin und Maßhalten. Hinzu kommen die Werte, die beim redlichen Kaufmann selbstverständlich sein sollten: Ehrlichkeit, Anstand und Integrität.“ Wobei die Personalverantwortliche klarstellt, dass dies keine lobenswerten Kann- Eigenschaften sind. „Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft als Ganzes verlangen von jedem Mitarbeiter einer Bank, insbesondere von ihren Führungskräften, dass sie sich untadelig verhalten. Daher sind das die Kriterien, nach denen wir bei der Personalsuche entscheiden, ob jemand zu uns passt.“ Zudem hat die Deutsche Bank laut Kirn einen „unmissverständlichen Verhaltenskodex“ definiert, den jeder Mitarbeiter kennen und leben muss. Und noch etwas ist den Banken wichtig: Sie sind auf der Suche nach Talenten, deren Horizont weit über die Zahlenanalytik hinausgeht. Die Branche hat begriffen, dass es ein Problem ist, wenn sich einige Bereiche eines großen Bankhauses vom Bedürfnis der Gesellschaft nach Sicherheit oder Nachhaltigkeit abkoppeln. Daher haben derzeit auch Kandidaten eine Chance, die als Seiteneinsteiger in die Finanzbranche einsteigen und die Teams mit anderen Ansichten und Perspektiven ergänzen. „Ein wirtschaftswissenschaftlicher oder mathematischer Studienhintergrund ist nicht zwangsläufig Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung“, sagt Anke Kirn. „Wir suchen neben Wirtschaftswissenschaftlern auch Naturwissenschaftler, Juristen, Informatiker und Ingenieure mit wirtschaftlichem Schwerpunkt.“ Doch auch für Seiteneinsteiger gilt: Der Studienabschluss sollte gut bis sehr gut sein. Wichtiges Kriterium ist in den meisten Bereichen zudem ein verhandlungssicheres Englisch – am besten erworben in einem Auslandssemester oder durch praktische Erfahrungen im Ausland. Gute Chancen im Bereich Compliance Wer wissen möchte, welche weiteren Talente und Kenntnisse für Einsteiger in der sich wandelnden Bankenbranche wichtig sind, ist bei Thomas Haibach an der richtigen Adresse. Der Personalberater ist Geschäftsführer der Personalberatungsgesellschaft Haibach & Cie., die sich auf die Beratung von Banken und Asset-Management- Gesellschaften spezialisiert hat. Seit 1994 unterstützt er Kunden aus der Finanzbrauche beim Auf- oder Ausbau von Abteilungen. Sein Credo: „Banken suchen authentische Bewerber, die im Rahmen ihrer Ausbildung und während des Studiums bereits praktische Erfahrungen in Unternehmen gesammelt haben.“ Wichtig seien auch eine schnelle Auffassungsgabe sowie das Talent, sich flexibel auf wechselnde, stetig neue Herausforderungen einzustellen. „Die Arbeitgeber erwarten zudem, dass man es versteht, ganzheitlich zu denken sowie komplexe Sachverhalte adressatengerecht darzustellen“, sagt Haibach. Mit Blick auf die Abteilungen und Themen, in denen sich aktuell die besten Karrierechancen ergeben, nennt der Personalberater die Bereiche Risikomanagement, Controlling, Rechnungswesen und Recht – wobei besonders die immer neuen Regulierungen weiterhin einen steigenden Bedarf nach Compliance- Spezialisten hervorrufen werden. Absolventen und Einsteiger sind also gut beraten, ihren Blick auf Bereiche zu richten, in denen die Banken an soliden Lösungen für die Stärkung ihrer Geschäftsgrundlage arbeiten. Sich kreativ austoben zu können, gehört aktuell dagegen nicht zu den besonders stark nachgefragten Eigenschaften. Das gilt auch für das Investmentbanking, der Sparte, die besonders von den Veränderungen der gesamten Branche betroffen ist. Trotz aller negativer Schlagzeilen: Die großen Asset-Manager haben ihre Talentsichtung nicht eingestellt und suchen wieder nach Top-Nachwuchs. So beginnt J.P. Morgan im Spätsommer mit dem Recruiting und hält dabei Ausschau nach Kandidaten, die den aktuellen Anforderungen der Branche gerecht werden. „Wir erkennen einen klaren Trend hin zu konservativen Anlagestrategien“, sagt Marketing- Direktor Jean Guido Servais. Die Verunsicherung vieler Anleger sei noch immer groß – nun komme es für Investmentbanker darauf an, dem Kunden überzeugend darzustellen, dass auch langfristig orientierte Anlagen attraktive Erträge erwirtschaften können. Den Wandel mitgestalten Gefragt sind also Nachwuchsberater, denen es gelingt, die Vorsicht der Anleger zu respektieren und auf dieser Basis Anlagestrategien zu entwickeln, die kurzfristig vorsichtig wirken mögen, langfristig aber in der Lage sind, die Renditen der risikoreichen, auf Kurzfristigkeit orientieren Strategien in den Schatten zu stellen. „Gerade bezüglich des Themas Altersvorsorge ist der langfristige Erfolg elementar“, sagt Servais – was wiederum zeigt, worauf es beim Investmentbanking heute ankommt: Die Aussicht auf schnelles Geld spielt eine immer geringere Rolle, stattdessen investieren Anleger in eine sichere Zukunft. Wer als Nachwuchskraft dieses Bedürfnis versteht, wird erleben, dass die Investmentbranche weiterhin ausgezeichnete Karrierechancen bietet. Und zwar, wie es bei J.P. Morgan heißt, in allen Bereichen – von Sales, Trading und Research über Risikomanagement bis zum Quantitative Research, also der Bewertung von Produkten, Preisen, Märkten und Anlegerbedürfnissen. Wenn der Trend bei den Banken zur soliden Nachhaltigkeit geht, stellt sich die Frage: Regiert die Angst das Geschäft? Spielt persönlicher Freiraum keine Rolle mehr? Targobank-Personaldirektorin Claudia Gutscher beruhigt alle Absolventen, die beim Einstieg besonderen Wert darauf legen, persönliche Gestaltungskraft zu entwickeln und anzubringen: „Die Branche befindet sich nicht nur in einer herausfordernden, sondern auch in einer spannenden Situation. Der Bankenmarkt verändert sich, und Veränderungen sind immer mit neuen Möglichkeiten und Perspektiven verbunden.“ Der Wandel in der Bankenbranche stelle die Geldhäuser vor eine große Aufgabe. Gutscher ist daher überzeugt: „Daraus ergeben sich Chancen – insbesondere für die Mitarbeiter, die in diesem Wandelprozess vieles mitgestalten können.“ So komme es zum Beispiel bei Bankberatern darauf an, einen Beratungsansatz zu entwickeln, der besonders auf die Individualität der Kunden Rücksicht nimmt. Claudia Gutscher nennt weitere Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um in diesem Bereich nach vorne zu kommen: „Die wichtigen Kriterien sind Kundenorientierung, Beratungskompetenz, Verhandlungs-geschick und Einfühlungsvermögen.“ Und es gilt: Zahlen sind die Grundlage – doch besitzen diese für jeden Kunden eine andere Bedeutung. Bei jedem von ihnen erzählt der Bedarf für eine Geldanlage oder Investition eine eigene Geschichte. Diese muss ein Anlageberater herauskitzeln, verstehen und in eine Strategie umsetzen. Gutscher sagt: „Jeder Kunde ist anders, es gibt keine einheitliche Vorgehensweise und gerade das macht vieles spannend.“karriereführer consulting 2012.2013
Im Fokus der Berater – Die Personalwirtschaft sucht Consultants
Leidenschaft. Wer als Consultant in die Personalmanagement-Beratung einsteigen möchte, sollte kaufmännisch denken können und sich nicht nur für Instrumente interessieren, sondern auch für Prozesse und die Umsetzbarkeit von Konzepten. Hierfür ist neben fundiertem Fachwissen auch einschlägige Praxiserfahrung, unternehmerisches Denken sowie psychologisches Talent gepaart mit Sozialkompetenz nötig. Und wenn zu alledem noch die Leidenschaft hinzukommt, sind die Aussichten auf einen etwas anderen Beraterjob hervorragend. Unternehmerische Denke und psychologisches Talent Die Consultingbranche sucht Berater für die Personalwirtschaft. “Spezialisieren Sie sich erst später” Dr. Walter Jochmann, Mitglied der Geschäftsführung von Kienbaum Consultants International sowie Vorsitzender der Geschäftsführung von Kienbaum Management Consultants, im Interview.Top-Manager:
Interview mit Dr. Frank Wierlemann, Gründer und Vorstand von Inverto Der Gründer und Vorstand von Inverto im Interview.Bewerben
Der Weg zur klaren Aussage Case Studies sind beliebte Methoden im Bewerbungsgespräch.Special Top-Player
Steile Lernkurve Kaum eine Branche ist dynamischer und vielseitiger als die Topmanagement-Beratung. Flexibel, engagiert, spontan Bei Charlotte Pallua kam alles anders als geplant. Heute Finanzdienstleistung, morgen Industriegüter Nicolas Schweizer arbeitet als Consultant beim Top-Player The Boston Consulting Group.Einsteigen
Jung und erfolgreich bei: Volkswagen Consulting Jens-Olav Jerratsch berichtet über seine Arbeit als Berater. Verantwortung von Anfang an Studentische Unternehmensberatungen bieten professionelle Praxiserfahrung.Aufsteigen
Ganzheitliche Sichtweise Christine Neeb über die Besonderheit, kleine und mittelständische Unternehmen zu beraten. Up or Out ist out Das langjährige Karrieremodell der Beraterbranche hat ausgedient.Projekt
Die kreative Kraft des Einkaufs In der Consulting-Szene arbeiten immer mehr Einkaufsberater.Handzeichen
Jonathan Briefs, Businesscoach und Humorberater Handschriftliches vom Businesscoach und Humorberater, der die österreichischen Skispringer auf Wettkämpfe vorbereitet.Service: Aktuelle Firmenporträts (Consulting) für Ihre Bewerbung
Booz & Company GmbH CTcon GmbH Deloitte Deutsche Post DHL Inhouse Consulting Ebner Stolz Mönning Bachem Unternehmensberatung GmbH Horváth & Partner GmbH INVERTO AG Rölfs RP Management Consultants GmbH RWE Consulting GmbH Siemens Management Consulting SimCorp GmbH Steria Mummert Consulting AG Stern Stewart & Co. GmbHPartner
Entrepreneurs-Club IQB JOBWARE Career Venture TALENTS – Die JobmesseKomplette Ausgabe
E-Paper karriereführer consulting 2012.2013 Download karriereführer consulting 2012.2013 (ca. 17 MB) karriereführer consulting 2012.2013 in der Kiosk-App für das iPad karriereführer consulting 2012.2013 in der Kiosk-App für AndroidKarriere in der Automobilbranche
Studiengänge mit Schwerpunkt Automobil
An welchen Hochschulen lassen sich Fahrzeugtechnik, Kraftfahrwesen oder Automobildesign studieren? Welche Zulassungsbeschränkungen gibt es, und wann kann ich mit dem Studium beginnen? Hier finden Sie eine Zusammenstellung der Studiengänge mit dem Schwerpunkt Automobil. Zu den StudiengängenHochschulen mit Schwerpunkt Automobil
An welchen Universitäten, Fachhochschulen oder Berufsakademien kann ich Fahrzeugtechnik, Kraftfahrzeugwesen oder Automobildesign studieren? Wo werden verwandte Studiengänge angeboten? Zu den HochschulenFörderung
Ein Studium kann ganz schön ins Geld gehen, kommt dann noch ein Semester oder Praktikum im Ausland hinzu, ist der finanzielle Spielraum schnell ausgeschöpft. Stipendien, Bafög oder Auslands-Bafög bieten Unterstützung und Sicherheit. Der karriereführer gibt hilfreiche Tipps zu Antrag und Bewerbung. Zu den TippsLinks
Sie brauchen mehr Informationen, Anregungen oder Einblicke rund um die Automobilbranche? Verbände, Portale, Universitäten und Fachhochschulen – Der karriereführer hat eine Auswahl wichtiger, interessanter und nützlicher Links für Sie zusammengestellt. Zu den LinksRecruitingevents
Sie möchten wissen, wann dieses Jahr Recruitingmessen stattfinden? Dann schauen Sie in unserer Rubrik Recruiting-Events vorbei, dort finden Sie alle Termine.Interview mit Hans-Joachim Stuck
Die Rennsportlegende Hans-Joachim Stuck ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rennfahrer Deutschlands. Seit Januar 2008 arbeitet er als Motorsport-Repräsentant für Volkswagen.
Zum Interview.
Hans-Joachim Stuck ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rennfahrer Deutschlands. Seit Januar 2008 arbeitet er als Motorsport-Repräsentant für Volkswagen.
Zum Interview.
Special aus dem karriereführer ingenieure
Einstieg in die Automobilbranche Eine besondere Faszination geht seit jeher vom Auto aus. Grund genug für den karriereführer ingenieure, diesem ein Special zu widmen. Darin lassen sich Ingenieure über die Schulter schauen, die abseits der großen Hersteller ihrer automobilen Leidenschaft frönen – sei es bei Kleinstmanufakturen oder Tuningbetrieben. Das Special finden Sie hier.Links zur Automobilbranche
- Automobilverbände
- Portale
- Universitäten und Fachhochschulen
- Zeitungen und Zeitschriften
- Wirtschaft
- Automobilclubs
Zeitungen Automobile
- Auto Bild www.autobild.de
- auto motor sport www.motor-presse-online.de
- Auto Zeitung www.autozeitung.de
- Autohaus www.autohaus-online.de
- Automobil Entwicklung www.automagazine.de
- Automobil Produktion www.automagazine.de
- Automobiltechnische / Motortechnische Zeitschrift www.atz-mtz.de
- Automobilwoche www.automobilwoche.de
- Krafthand www.krafthand.de
- lastauto omnibus www.lastauto.de
- Logistik Heute www.logistik-heute.de
- mot www.motor-presse-online.de
- OmnibusRevue + Bus Aktuell www.busaktuell.de/
- trans aktuell www.eurotransport.de
- Transport www.transportonline.de
- VDI Nachrichten www.vdi-nachrichten.com
- Verlag moderne industrie AG automagazine.de
Wirtschaft
- American Chamber of Commerce in Germany e.V. www.amcham.de
- Arbeitgeberverband Gesamtmetall www.gesamtmetall.de
- Bundesverband der Deutschen Industrie www.bdi-online.de
- Deutsche Wirtschaft (Datenbank) www.deutsche-wirtschaft.de
- Deutsches Verbände Form www.verbaende.com
- Informationsdienst des Instituts der Deutschen Wirtschaft www.iwkoeln.de
- Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) www.iwkoeln.de
- Rationalis.- und Innovationszentrum der dt. Wirtschaft (RKW) www.rkw.de
- Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft www.stifterverband.de
- THINK-ING in Hessen
- Verbandsforum www.verbandsforum.de
- Verein Deutscher Ingenieure (VDI) www.vdi.de
Automobilverbände
- Europäischer Automobilherstellerverband ACEA in Brüssel www.acea.be
- Weltautomobilherstellerverband OICA in Paris www.oica.net
- Verband der Automobilindustrie e.V. www.vda.de
- Bundesverband der Karosserie- und Fahrzeugbauer www.karosseriebauer.de/index2.html
- Automobilverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft www.avdg.be
- Belgien (FEBIAC) www.febiac.be
- Brasilien (ANFAVEA) www.anfavea.com.br
- Frankreich (CCFA) www.ccfa.fr
- Großbritannien (SMMT) www.smmt.co.uk
- Italien (ANFIA) www.anfia.it
- Japan (JAMA) www.japanauto.com
- Kanada (CVMA) www.cvma.ca
- NEVAT Holland Automotive www.nevat.nl
- Niederlande (RAI) www.autorai.nl
- Spanien (ANFAC) www.anfac.com
- US-Amerikanischer Zulieferverband MEMA in Washington www.mema.org
- USA (AAM) Automobilhersteller www.autoalliance.org
Internetportale zum Thema Automobile
- Automobil-Blog.de – das Online-Magazin www.automobil-blog.de
- ADAC-Drive, der Jugendclub des ADAC www.jungesportal.de
- Autojournal www.autojournal.de
- Focus – Auto und Verkehr www.focus.de/auto/
- Auto.Abacho.de auto.abacho.de
- Autokiste – Das neue Auto-Portal www.autokiste.de/
- Automotive Intelligence www.autointell.de
- Automotive Online www.automotive-online.com
- Autoscout24.de www.autoscout24.de
- auto.t-online.de www.auto.t-online.de
- car4you.ch www.car4you.ch
- Classic Driver – The European Car WebZinec www.classicdriver.de
- Motorline.cc www.motorline.cc
- RP-Online Auto und Verkehr www.rp-online.de/leben/auto/
- wunschauto24.com Alles rund ums Autofahren: Das Autofahrer-Portal wunschauto24.com besticht vor allem durch seinen ausgeprägten Service-Charakter: Neben aktuellen News und Infos gibt es Links, Tipps und Angebote wie Routenplaner oder Staumelder. http://wunschauto24.com