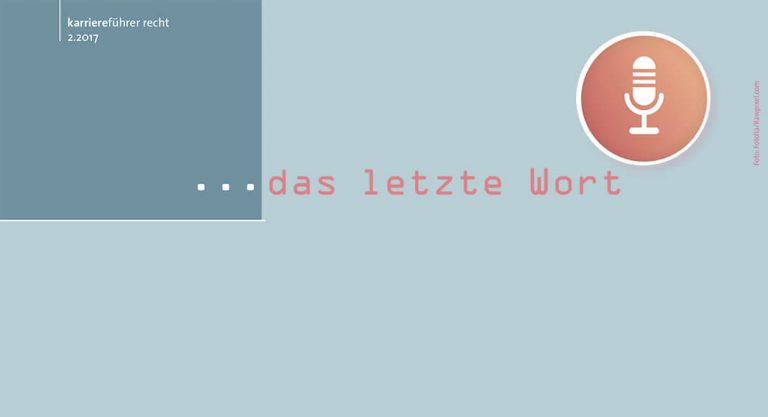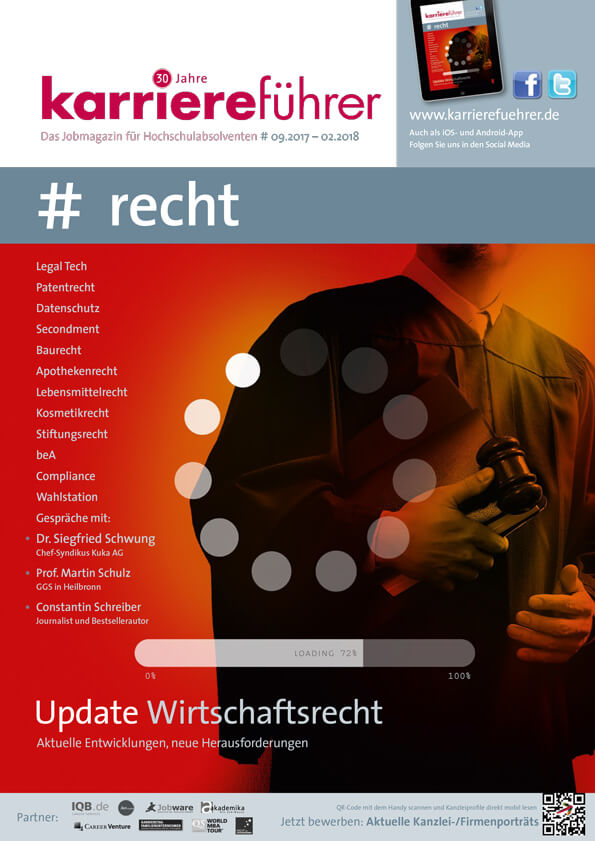Alle reden über Legal Tech, immer mehr Start-ups werden auch im juristischen Bereich sichtbar. Doch was steckt hinter dem Hype? Gerade für technologische Innovationen zeigt sich der Rechtsmarkt als schwierig. Die inhaltliche Komplexität der Materie und der heterogene Markt haben das „Uber der Anwälte“ bisher verhindert. Gibt es aber nicht doch auch Technologien, die funktionieren, und Start-ups, die für junge Anwälte interessant sein können? Von Michael Grupp, Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter des Automationsdienstleisters Lexalgo in Darmstadt und Mitglied in der Executive Faculty des Bucerius Center of the Legal Profession an der Bucerius Law School in Hamburg
Erinnern Sie sich an Advopolis? Wahrscheinlich nicht – das Start-up versuchte schon 1998 mit einer virtuellen Umgebung Rechtsrat zu vermitteln – online und digital versteht sich. Das Projekt scheiterte allerdings mitten in der Blase des neuen Marktes. Überhaupt blieben Start-ups in der juristischen Branche selten. Online-Urgesteine, wie die QNC GmbH, die schon seit fast 20 Jahren die Plattformen 123Recht.net und frag-einen-Anwalt.de betreibt, oder der Vertragsgenerator der Janolaw AG im Taunus sind die bekannten Ausnahmen.
Lesetipp
Dr. Tobias Fuchs, Partner Leiter Technologie, Medien & Telekommunikation bei der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, hat sich in einer Mandanten- Information mit „Lawyer 4.0 – Legal Tech, lernfähige Algorithmen und analoges Recht“ beschäftigt: https://goo.gl/tTpDbW
Erst in den letzten Jahren werden auch im juristischen Bereich Start-ups sichtbar – inzwischen sicher um die 50 in Deutschland. Ein Grund dafür ist die generell zugänglichere Technik – Webseiten lassen sich heute per Mausklick erstellen, technologisches Know-how ist leichter verfügbar. Und seit den globalen Erfolgsprojekten Facebook, Google und Co. sind Start-up-Gründungen auch salonfähig geworden und finanzierbar.
Ein vitales Ökosystem aus Kapitalgebern, Inkubatoren und zunehmend auch Partnern aus der Industrie ermutigt auch Juristen zum Gründen. Der Trend lässt sich international nachzeichnen, in fast allen Ländern hat die Start-up-Welle inzwischen die juristische Branche erreicht.
Der Rechtsmarkt ist anders
Das ist aber eigentlich nicht selbstverständlich, denn anders als stark produktbezogene Branchen ist der Rechtsmarkt für digitale und innovative Dienste schwer zu beackerndes Land. Das liegt zunächst an der Materie selbst, aber auch an der Marktstruktur: Der Charme und eigentliche Zweck von Start-ups liegt in der Skalierbarkeit: Wachstumsunternehmen werden gegründet, um schnell mit innovativen Technologien oder Geschäftsmodellen zu wachsen und wertgesteigert wieder verkauft zu werden. Das unterscheidet Start-ups von traditionellen Unternehmensgründungen oder der Selbstständigkeit. Diese Skalierbarkeit bestand bis 2010 oft in der Digitalisierung des Vertriebs. Seit 2012 liegen vor allem Automationen im Fokus.
Im juristischen Bereich kommen diese Technologien aber an ihre Grenzen: Recht ist kein Produkt, der menschliche Kontakt ist noch immer ein entscheidender Faktor. Ein richtiger E-Commerce für juristische Dienstleistungen hat sich deshalb nicht gebildet. Obwohl mehrere Plattformen wie Jurato aus Berlin oder Advocado aus Greifswald einen Weg gefunden haben, Rechtsrat online zu vermitteln, kommt das Gros der Dienstleistungserbringung auf traditionellem Wege zu Stande. Wer heute innovativ ist, verbessert eher das Google-Ranking, nimmt Youtube-Videos auf oder bietet eine App an. Mehr Technologie lässt das Anwalts- Mandanten-Verhältnis heute kaum zu.
Rechtsberatung ist kein Produkt
Der zweite Grund betrifft die juristische Materie selbst: Rechtsberatung ist Dienstleistung. Und diese Dienstleistungserbringung, die Rechtsfindung, lässt sich nur schwer formalisieren. Die wenigen Ausnahmen sind schnell aufgezählt: Nach den Vorbildern legalzoom. com oder RocketLawyer gibt es zum Beispiel mit SmartLaw, inzwischen von WoltersKluwer übernommen, auch im deutschen Markt Online-Vertragsgeneratoren, die es den Nutzern ermöglichen, individuelle Verträge selbst zu generieren. Das spart Zeit und Geld. Und obwohl die juristische Beratung dabei entfällt, haben sich diese interaktiven Versionen der Musterformularhandbücher für häufige und standardisierbare Vertragstypen etabliert – wie Mietverträge, Arbeitsverträge oder Vereinbarungen im Familien- und Erbrecht.
Linktipp
Eine Auflistung über Legal Tech-Unternehmen in Deutschland findet sich unter: http://tobschall.de/legaltech
Doch darüber hinaus wird es schwierig: Die juristische Materie ist semantisch hochkomplex. Um den Bedeutungsgehalt einer juristischen Formulierung zu erfassen, bedarf es umfangreichen Wissens, Interpretationen und Wertungen. Subsumtionen, die Juristen leicht möglich sind, überfordern den Computer. Die technologischen Möglichkeiten, die in anderen Branchen wie dem Finanzbereich oder der Medizin schnell euphorisieren, helfen im juristischen Bereich, wo Zahlen und Bilddaten kaum eine Rolle spielen, deshalb nicht weiter.
Künstliches Textverständnis gelingt nur dort, wo sehr viele und sehr ähnliche Daten das Trainieren von Modellen wie neuronalen Netzen ermöglichen. Legal Tech-Softwareanbieter wie Leverton, Kira oder Epiq können aus großen Vertragsmengen Abweichungen oder Zusammenhänge erkennen. Das beschleunigt zum Beispiel die Due Diligence bei wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungen oder beim Unternehmenskauf. Aber eine im engeren Sinne juristische Prüfung lässt sich so nicht ersetzen. Auch Projekte wie die Kooperation mit dem IBM Watson Supercomputer, ROSS, bleiben noch konkrete Anwendungsfälle schuldig.
Was funktioniert wirklich?
Start-ups haben sich deshalb auf Bereiche spezialisiert, in denen Automationen trotz dieser Schwierigkeiten möglich sind, wo also Fälle nicht nur sehr ähnlich und sehr häufig, sondern auch mit hohem Formalisierungsgrad vorkommen. So hilft das Potsdamer Start-up flightright.de bei der Abwicklung von Erstattungsfällen nach der Fluggastrechte-Verordnung. Ähnliche Anwendungen gibt es für Bußgeldfälle mit geblitzt.de, für Fahrradunfälle mit bikeright.de oder für Verbraucherverträge mit aboalarm.de.
Schon stärker in einen bislang von Anwälten besetzten Markt greifen Anwendungen für Mietrecht, zum Beispiel wenigermiete.de ein. In Unternehmen und großen Rechtsabteilungen, wo sich große und ähnliche Fallmengen ebenfalls bündeln lassen, kommen Legal Tech-Anbieter zum Zug, die bei der Herstellung eigener Prüfungstools helfen: Mit Knowledgetools von Prof. Breidenbach oder dem von der ESA unterstützten Unternehmen Lexalgo können Unternehmen und Kanzleien Expertensysteme selbst entwickeln lassen, die in häufig auftretenden Fällen Aufwand reduzieren.
Das jüngst gestartete Berliner Unternehmen Lawlift hilft Kanzleien ganz ohne Entwicklungs- Know-how, eigene interaktive Musterformulare zu erstellen. Zu diesen Anwendungen für Rechtsautomationen kommen vermehrt Management-Tools, die nicht die Rechtsfindung, aber die tägliche Arbeit vereinfachen und verbessern, von Lösungen zur Optimierung von Workflow, Projektmanagement und Kommunikation wie das Frankfurter Unternehmen Streamlaw bis zur Vereinfachung der Stundenerfassung und Rechnungsstellung, wie es beispielsweise von busylamp.de angeboten wird.
Der Blog zum Thema
Dr. Micha-Manuel Bues informiert in seinem „Legal Tech Blog“ zu den Themen Legal Tech, Legal Innovation und Legal Start-ups: http://legal-tech-blog.de
Die Zukunft des Rechtsmarkts bleibt menschlich
Obwohl im Fokus der juristischen Fachpresse, halten sich die umwälzenden Innovationen noch zurück. Das ist trotzdem keine Jobgarantie für Rechtsanwälte, denn die Innovationszyklen werden kürzer. Immer mehr Projekte werden sichtbar und mit der Beteiligung von Wirtschaftskanzleien und Universitäten bildet sich auch in der juristischen Branche ein innovationsfreundliches Klima. Für junge Juristen bedeutet die Entwicklung der letzten Jahre vor allem: Technologie wird Erfolgsfaktor. Anwälte müssen nicht unbedingt Programmieren lernen, aber der natürliche und proaktive Umgang mit technologischen Neuerungen wird auch für Juristen ab heute über den langfristigen Erfolg entscheiden. Wenigstens in diesem Punkt sind wir anderen Branchen sehr ähnlich. Wir Anwälte brauchen den Roboter-Anwalt nicht zu fürchten – wohl aber den Anwalt, der sich mit Robotern auskennt.











 Ulrike Wewers: Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Deutscher Anwalt Verlag 2017. 39,00 Euro.
Ulrike Wewers: Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Deutscher Anwalt Verlag 2017. 39,00 Euro.
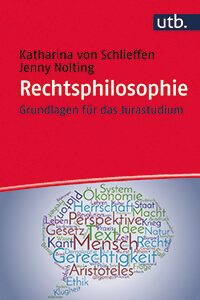 Katharina Gräfin von Schlieffen und Jenny Nolting haben mit „Rechtsphilosophie“ ein Grundlagenbuch geschrieben, in dem die wichtigsten Philosophen vergangener Jahrhunderte und deren Gedanken zu Recht und Gerechtigkeit vorgestellt werden. Da jede der Philosophien mit einem höchstrichterlichen Urteil der Gegenwart in Verbindung gebracht wird, werden neben historischen Einmaligkeiten auch zeitübergreifende Rechtskonzepte deutlich. Katharina Gräfin von Schlieffen, Jenny Nolting: Rechtsphilosophie. utb 2017. 24,99 Euro.
Katharina Gräfin von Schlieffen und Jenny Nolting haben mit „Rechtsphilosophie“ ein Grundlagenbuch geschrieben, in dem die wichtigsten Philosophen vergangener Jahrhunderte und deren Gedanken zu Recht und Gerechtigkeit vorgestellt werden. Da jede der Philosophien mit einem höchstrichterlichen Urteil der Gegenwart in Verbindung gebracht wird, werden neben historischen Einmaligkeiten auch zeitübergreifende Rechtskonzepte deutlich. Katharina Gräfin von Schlieffen, Jenny Nolting: Rechtsphilosophie. utb 2017. 24,99 Euro.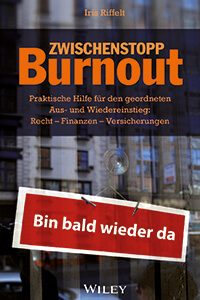 Die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Iris Riffelt erklärt in der Neuauflage ihres Buches „Zwischenstopp Burnout“, welche arbeitsrechtlichen Gesichtspunkte und finanziellen Fragen geklärt sein sollten, bevor die Notbremse bei den ersten Anzeichen eines Burnouts gezogen wird. Damit zeigt sie, dass und wie man aus dem Berufsleben aussteigen kann und welche Auswirkungen das auf das Einkommen hat. Ein weiterer Schwerpunkt des Fachbuchs ist der berufliche Wiedereinstieg für alle, die sich auf dem Weg der Besserung befinden und sich zutrauen, ihre Arbeit Stück für Stück wieder aufzunehmen. Iris Riffelt: Zwischenstopp Burnout. Wiley-VCH, 2. Auflage 2017. 16,99 Euro.
Die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Iris Riffelt erklärt in der Neuauflage ihres Buches „Zwischenstopp Burnout“, welche arbeitsrechtlichen Gesichtspunkte und finanziellen Fragen geklärt sein sollten, bevor die Notbremse bei den ersten Anzeichen eines Burnouts gezogen wird. Damit zeigt sie, dass und wie man aus dem Berufsleben aussteigen kann und welche Auswirkungen das auf das Einkommen hat. Ein weiterer Schwerpunkt des Fachbuchs ist der berufliche Wiedereinstieg für alle, die sich auf dem Weg der Besserung befinden und sich zutrauen, ihre Arbeit Stück für Stück wieder aufzunehmen. Iris Riffelt: Zwischenstopp Burnout. Wiley-VCH, 2. Auflage 2017. 16,99 Euro. Spiegel Online ernannte Werner Koczwara einst zum „Erfinder des juristischen Kabaretts“. Das mag daran liegen, wie er selbst schreibt, dass er realsatirische Paragrafen und unfreiwillig komische Urteile präsentiert und dadurch die Komik des Justizstandor ts Deutschland auslotet . Koczwara tritt dabei auch regelmäßig in Gerichtssälen und bei juristischen Kongressen auf. Programme seines bereits 1983 begonnenen Schaffens tragen beispielsweise die Titel „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“, „Tyrannosaurus Recht“ oder „Einer flog übers Ordnungsamt“. Erstgenanntes erschien 2010 auch als Buch. 2017 erhielt Werner Koczwara den Hauptpreis beim Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis 2017. Weitere Infos unter:
Spiegel Online ernannte Werner Koczwara einst zum „Erfinder des juristischen Kabaretts“. Das mag daran liegen, wie er selbst schreibt, dass er realsatirische Paragrafen und unfreiwillig komische Urteile präsentiert und dadurch die Komik des Justizstandor ts Deutschland auslotet . Koczwara tritt dabei auch regelmäßig in Gerichtssälen und bei juristischen Kongressen auf. Programme seines bereits 1983 begonnenen Schaffens tragen beispielsweise die Titel „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“, „Tyrannosaurus Recht“ oder „Einer flog übers Ordnungsamt“. Erstgenanntes erschien 2010 auch als Buch. 2017 erhielt Werner Koczwara den Hauptpreis beim Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis 2017. Weitere Infos unter: 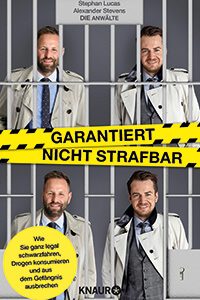 Die Gesetze wimmeln laut den TV-bekannten Anwälten Stephan Lucas und Dr. Alexander Stevens nur so von Widersprüchen und Lücken: Ob Verkehrsrowdy, Schwarzfahrer oder Dokumentenfälscher – wir alle dürfen viel mehr, als wir glauben. Lucas und Stevens geben in ihrem Buch „Garantiert nicht strafbar“ mit Fachkenntnis und viel Witz Einblick in die Welt des Strafgesetzbuchs. Danach gilt: Fast alles ist erlaubt – man muss nur die richtigen Paragrafen kennen! Stephan Lucas, Dr. Alexander Stevens: Garantiert nicht strafbar. Knaur TB 2017. 12,99 Euro.
Die Gesetze wimmeln laut den TV-bekannten Anwälten Stephan Lucas und Dr. Alexander Stevens nur so von Widersprüchen und Lücken: Ob Verkehrsrowdy, Schwarzfahrer oder Dokumentenfälscher – wir alle dürfen viel mehr, als wir glauben. Lucas und Stevens geben in ihrem Buch „Garantiert nicht strafbar“ mit Fachkenntnis und viel Witz Einblick in die Welt des Strafgesetzbuchs. Danach gilt: Fast alles ist erlaubt – man muss nur die richtigen Paragrafen kennen! Stephan Lucas, Dr. Alexander Stevens: Garantiert nicht strafbar. Knaur TB 2017. 12,99 Euro.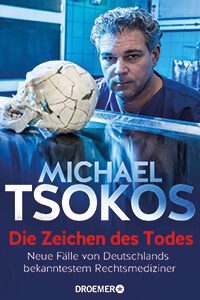 In dem neuen Sachbuch des Rechtsmediziners Professor Michael Tsokos geht es um Mord und Totschlag, um Verbrechen und rohe Gewalt. Er stellt Fälle vor, in denen er mit seiner rechtsmedizinischen Expertise den Ermittlungsbehörden entscheidende Hinweise geben konnte. Und in denen es immer um die Frage geht: War es Mord, Suizid ein Unfall – oder war es ein natürlicher Tod? Tsokos folgt den Spuren des Verbrechens und fügt die Indizien zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammen, das zur Rekonstruktion des Geschehens führt. Michael Tsokos: Die Zeichen des Todes. Droemer HC 2017. 19,99 Euro.
In dem neuen Sachbuch des Rechtsmediziners Professor Michael Tsokos geht es um Mord und Totschlag, um Verbrechen und rohe Gewalt. Er stellt Fälle vor, in denen er mit seiner rechtsmedizinischen Expertise den Ermittlungsbehörden entscheidende Hinweise geben konnte. Und in denen es immer um die Frage geht: War es Mord, Suizid ein Unfall – oder war es ein natürlicher Tod? Tsokos folgt den Spuren des Verbrechens und fügt die Indizien zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammen, das zur Rekonstruktion des Geschehens führt. Michael Tsokos: Die Zeichen des Todes. Droemer HC 2017. 19,99 Euro.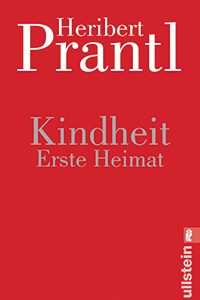 Für den gelernten Rechtsanwalt und Richter Heribert Prantl gibt es nur zwei Themen, über die zu reden sich wirklich lohnt: die Liebe und den Tod. Mit diesen existenziellen Fragen beschäftigt er sich auch in seinem Buch „Kindheit. Erste Heimat“. Darin geht es um Familien als ein Ort, der Sicherheit, Schutz und Nähe gibt: Jeder Ort, an dem Kinder das erfahren, ist Familie. Prantl wirbt im Umgang mit Kindern für eine antiautoritäre Autorität des Herzens. Und er fragt schließlich, wie das Leben im Sterben aussieht. Heribert Prantl: Kindheit. Erste Heimat. Ullstein 2017. 9,99 Euro.
Für den gelernten Rechtsanwalt und Richter Heribert Prantl gibt es nur zwei Themen, über die zu reden sich wirklich lohnt: die Liebe und den Tod. Mit diesen existenziellen Fragen beschäftigt er sich auch in seinem Buch „Kindheit. Erste Heimat“. Darin geht es um Familien als ein Ort, der Sicherheit, Schutz und Nähe gibt: Jeder Ort, an dem Kinder das erfahren, ist Familie. Prantl wirbt im Umgang mit Kindern für eine antiautoritäre Autorität des Herzens. Und er fragt schließlich, wie das Leben im Sterben aussieht. Heribert Prantl: Kindheit. Erste Heimat. Ullstein 2017. 9,99 Euro.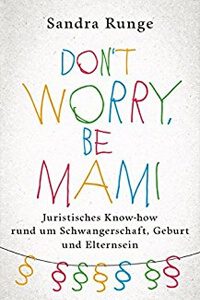 Als der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Sandra Runge am ersten Tag nach der Elternzeit die Kündigung überreicht wurde, war ihr klar: (Werdende) Eltern benötigen dringend Hilfe, sowohl gegenüber Arbeitgebern als auch im undurchsichtigen Paragrafen- und Behördendschungel. Also schrieb sie den Eltern-Rechtsratgeber „Don‘t worry, be Mami“ mit vielen nützlichen Tipps und Tricks, Checklisten und Mustertexten, verpackt in lustig-skurrile Alltagsgeschichten. Über ihre Erfahrungen, die mit zahlreichen Hilfestellungen garniert sind, bloggt sie auch auf www.smart-mama.de. Sandra Runge: Don‘t worry, be Mami. Blanvalet 2017. 12,99 Euro.
Als der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Sandra Runge am ersten Tag nach der Elternzeit die Kündigung überreicht wurde, war ihr klar: (Werdende) Eltern benötigen dringend Hilfe, sowohl gegenüber Arbeitgebern als auch im undurchsichtigen Paragrafen- und Behördendschungel. Also schrieb sie den Eltern-Rechtsratgeber „Don‘t worry, be Mami“ mit vielen nützlichen Tipps und Tricks, Checklisten und Mustertexten, verpackt in lustig-skurrile Alltagsgeschichten. Über ihre Erfahrungen, die mit zahlreichen Hilfestellungen garniert sind, bloggt sie auch auf www.smart-mama.de. Sandra Runge: Don‘t worry, be Mami. Blanvalet 2017. 12,99 Euro.