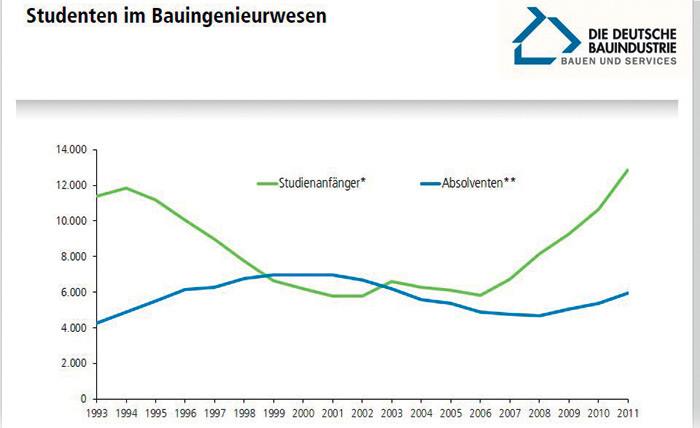Wann immer von Megatrends die Rede ist, fällt auch der Begriff Demografie. Unsere Gesellschaft altert. Und zwar rasant. Die Bertelsmann-Stiftung hat festgestellt: Während im Jahr 2006 noch jeder zweite Bundesbürger jünger als 42 Jahre alt war, wird die Hälfte der Bevölkerung im Jahr 2025 älter als 47 Jahre sein – in den ostdeutschen Bundesländern sogar älter als 53 Jahre. Doch geht unsere Gesellschaft diesen Wandel mit? Ist diese Entwicklung in unseren Bauten ablesbar? Nein, meint Heike Böhmer. Die Leiterin des Instituts für Bauforschung in Hannover beschreibt ihre Sicht auf die Demografie und die damit zusammenhängende Barrierefreiheit und erklärt, was Bauingenieure damit zu tun haben. Die Fragen stellte Christoph Berger
Diplom-Ingenieurin Heike Böhmer leitet das Institut für Bauforschung in Hannover. Die Bauingenieurin forscht dort mit ihren Kollegen zu den Themen Energieeinsparung, Barrierefreiheit, Qualitätssicherung, Zukunftsentwicklung, Verkehrssicherungspflichten in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Umweltverträglichkeit und Kostendämpfung. Darüber hinaus berät das Institut Unternehmen in diesen Bereichen. Außerdem wird der zertifizierte Fachplanerlehrgang „Barrierefreies Bauen“ gemäß DIN 18040 angeboten. Weitere Informationen unter: www.bauforschung.de
Frau Böhmer, es ist bekannt, dass unsere Gesellschaft im Durchschnitt immer älter wird. Spiegelt sich die Entwicklung auch in unseren Bauten wider?
Noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir merken, dass die Richtung stimmt, aber von einem Spiegel können wir noch nicht sprechen. In Bezug auf das Wort Barrierefreiheit haben viele an Planung und Bau Beteiligte noch immer Angst und Bedenken. Der Begriff klingt für viele weiterhin nach Heim und Krankenhaus, nach Plastikgriffen und fürchterlichen Bädern, die keiner mag.
Ist die Baubranche nicht auf die Entwicklung vorbereitet?
Zumindest nicht gut genug. Das fängt bei der Planung an, geht über die Ausführungsvorbereitung bis hin zu den Handwerkern. Es werden zwar vermehrt Weiterbildungen zu dem Thema besucht, auch Fachzeitschriften und Webseiten greifen es auf. Aber es gibt noch viel Potenzial nach oben.
Erkrankungen und Einschränkungen erfordern Anforderungen an Wohngebäude, das Wohnumfeld und den öffentlichen Raum. Was bedeutet also Barrierefreiheit?
Beim barrierefreien Bauen geht es nicht, wie häufig angenommen, ausschließlich um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. Der Begriff „Barrierefreiheit“ ist in Gesetzen und Normen definiert mit dem Ziel, durch die barrierefreie Gestaltung des gebauten Lebensraums, wie zum Beispiel der Gebäude oder des Wohnumfeldes, weitgehend allen Menschen die Nutzung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zu ermöglichen. So die Theorie. Die Praxis ist natürlich nicht ganz so einfach, denn die Zielgruppe ist sehr differenziert und der Bedarf hängt immer von den Einschränkungen ab. In der Öffentlichkeit nehmen wir meist nur das körperliche wahr, den Rollstuhl oder den Blindenstock. Bei Höreinschränkungen wird es schon schwieriger – auch was diese für den Bau erfordern. Die Notwendigkeiten, die sich aus psychischen Erkrankungen ableiten, können schließlich von Laien kaum erkannt werden. Es sind also unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Bauten, die 100 Prozent für alle barrierefrei sind, gibt es demnach auch nicht. Dieser Aufwand ist aus meiner Sicht nicht zu leisten. Man kann es aber schaffen, ein Gebäude für möglichst viele Nutzer und individuell für bestimmte Nutzer barrierefrei zu machen. Und darum geht es.
Wo liegen von Ihnen festgestellte Mängel bei den Bauten?
Das Hauptmanko liegt in der Umsetzung vereinbarter oder erforderlicher Ziele. Allerdings geht die gutachterliche Tätigkeit auf dem Gebiet erst los. Es ist relativ neu, dass sich Menschen mit diesbezüglichen Mängeln oder Schäden in ihren Wohnungen oder Häusern bei Versicherungen melden. Inhaltlich ist ein kritischer Punkt die Zugänglichkeit: Wie kann ich Räume oder Gebäude so nutzen, dass ich dort gut und sicher leben kann?
Trifft das auch auf öffentliche Gebäude oder die Immobilien von Unternehmen zu?
Bei öffentlichen Gebäuden gibt es üblicherweise die rechtliche Verpflichtung, dass alles, was modernisiert oder neu gebaut wird, barrierefrei zugänglich und damit nutzbar ist. Denken Sie zum Beispiel an Rathäuser, Bürgerämter, Theater. Dort ist Publikumsverkehr. In Firmen, in denen gehandicapte Personen arbeiten, die das Thema Barrierefreiheit brauchen, wird meist nach Bedarf angepasst, prophylaktisch eher nur im Neubaubereich.
Was können Bauingenieure dazu beitragen?
Wichtig ist die Beschäftigung mit dem Thema, das viel mehr als nur die Technik beinhaltet. Bauingenieure haben überwiegend mit Planen, Technik und Bauphysik zu tun. Den für das barrierefreie Bauen nötigen Sozialaspekt erwerben sie bisher vor allem in der Praxis. Das ist schade, denn man könnte früher ansetzen. Absolventen sollten wissen, was Demografie bedeutet und welche Einschränkungen welche Anforderungen an das Bauen an sich stellen. Wer hier vorbereitet ist, hat einen enormen Vorsprung.
Lernen durch die Praxis – was bedeutet das in diesem Kontext?
Ganz wichtig sind Kompetenz und Kommunikation. Die eigene fachliche Kompetenz als Grundlage zu kombinieren mit dem Erfahren spezieller und individueller Bedarfe, das ist die Kunst. Und auch: Wo hole ich mir das notwendige Wissen her? Das kommt nämlich nicht nur aus der Norm.
Wer sind die Arbeitgeber für Absolventen im Bereich des barrierefreien Bauens?
Alle am Bau beteiligten Firmen – vor allem Bauunternehmen, Architekturund Ingenieurbüros. Diese machen jedoch nicht die Ansage: Ihr müsst jetzt nur noch barrierefrei planen und bauen! Aber in Zukunft werden Experten in diesem Bereich in allen Branchen gebraucht. Der Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär ist vorangegangen. Bei Bädern ist das Thema barrierefreier Konzepte mittlerweile schon recht etabliert. Bei den Planern sind es derzeit vor allem die Themen betreutes Wohnen, Mehrgenerationshäuser und Heime. Zukünftig werden sich diese Bereiche ausweiten auf den gesamten Planungs- und Bauprozess.
Wie schätzen Sie die Perspektiven für Bauingenieure in dem Bereich ein?
Perfekt. Sowohl für die, die planen, als auch für diejenigen, die mit der Umsetzung betraut sind. Und weitergedacht auch für die Sachverständigen. Es muss jemand da sein, der entsprechend den Vereinbarungen prüft, ob etwas tatsächlich barrierefrei ist. Der Bedarf an solchen Experten wird extrem steigen.
Und warum ist das Thema barrierefreies Bauen spannend für Bauingenieure?
Weil man aus allen Bereichen des Lebens Dinge einbinden kann: Technik, Soziales, Wirtschaft, Gesundheit – das Spannungsfeld zwischen diesen Bereichen gilt es zu koordinieren. Das finde ich großartig. Zum anderen hat der Bereich eine Zukunft wie kaum ein anderer am Bau.
[quote_center]
Barrierefreiheit
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt Informationen zum Thema Barrierefreiheit unter der Internetadresse www.einfach-teilhaben.de zur Verfügung. Eine Auflistung mit Auszügen aus der Musterbauordnung und einzelnen Paragraphen zu barrierefreiem Bauen aus den Landesbauordnungen der Bundesländer und eine Liste der Technischen Baubestimmungen zu barrierefreiem Bauen finden sich hier: nullbarriere.de/bauordnungen.htm
DIN 18040
Die für das barrierefreie Bauen wesentliche Norm ist die DIN 18040 „Barrierefreies Planen und Bauen – Planungsgrundlagen“. Laut Heike Böhmer ist die Norm „sehr zielorientiert“. Sie setzt viele Kompetenzen voraus und beschreibt weniger, wie etwas ganz genau zu bauen ist. Bauingenieure brauchen ihrer Meinung nach deshalb umfassende Kompetenzen, um Sachverhalte zu verstehen, einzuschätzen und umzusetzen.
www.din18040.de[/quote_center]