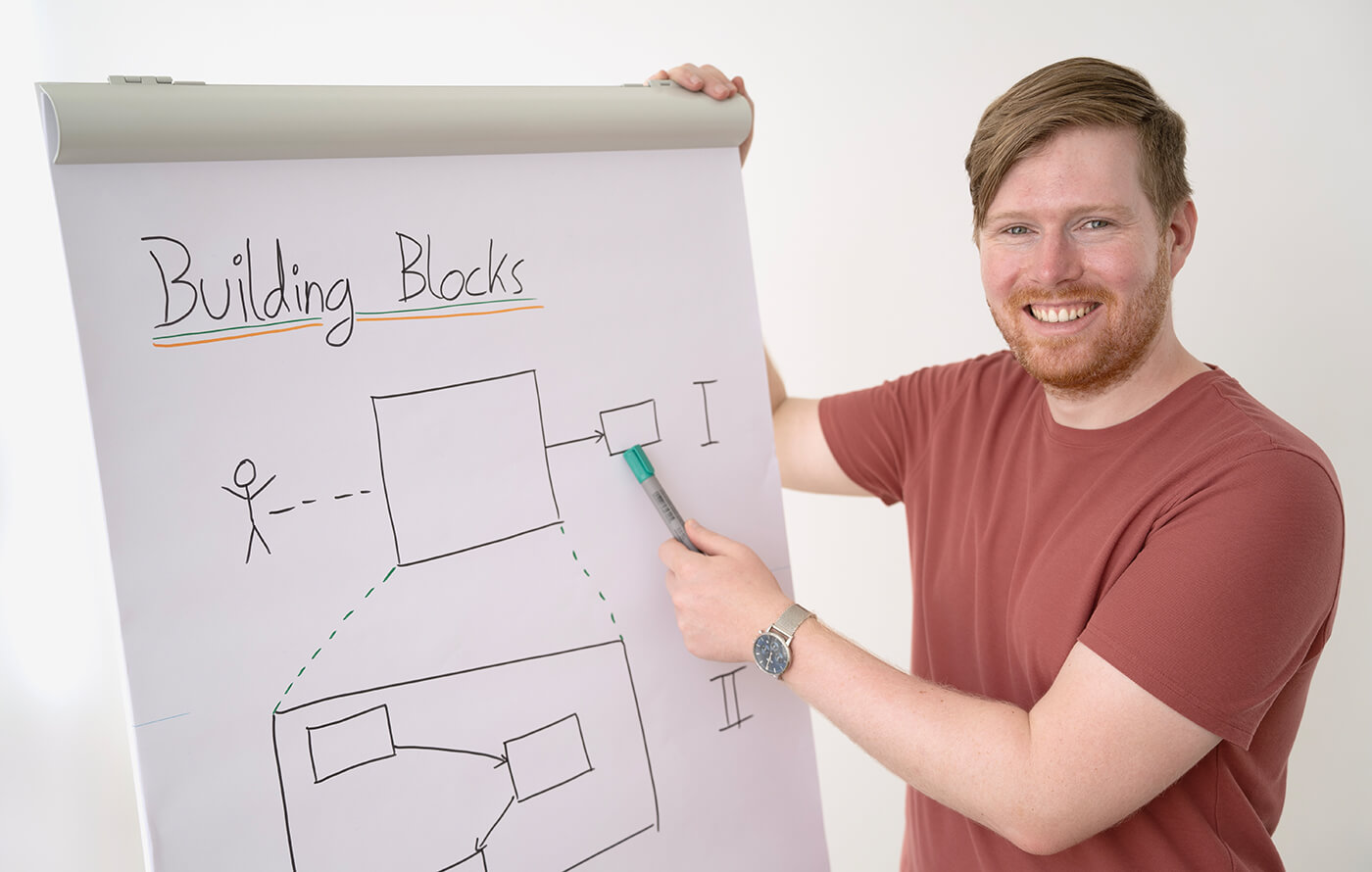Marcus Helds Karriere begann früh: Mit zwölf programmierte er seine erste Website, mit 17 gründete er eine Agentur. Der Weg führte ihn über die Spieleindustrie und verschiedene IT-Führungspositionen schließlich in die Selbstständigkeit. Heute arbeitet Held als freier Software-Architekt und berät Unternehmen mit überkomplexen Strukturen. Im Gespräch erzählt er, wie er in die Branche kam, warum er Java lieben lernte – und weshalb er aus dem Management zurück in die Technik wollte. Außerdem erklärt er, warum KI die Softwareentwicklung verändern wird – und was das für Berufseinsteiger bedeutet. Von Sonja Theile-Ochel
Zur Person
Jahrgang 1992, Informatiker. Sieben Jahre in der Hamburger Spieleindustrie, später Teamleiter und Abteilungsleiter in einem IoT-Unternehmen in Köln. Seit 2022 freier Software-Architekt. Held hält regelmäßig Vorträge auf Konferenzen, schreibt Fachartikel und engagiert sich im Verein „ADEPT“ für unabhängige IT-Beratung.
Herr Held, wie hat bei Ihnen alles angefangen?
Ich war schon immer ein Technik-Typ. Mit zwölf habe ich meine erste Website gebaut – damals brauchten plötzlich auch Friseure oder kleine Läden eine Online-Präsenz. Schnell sprach es sich herum, und ich baute für Bekannte und deren Bekannte Seiten. Mit 17 war das so groß geworden, dass ich zusammen mit einem Freund eine Agentur gründete. Eigentlich wollte ich aber in die Spieleindustrie: Der Mix aus Logik, Technik und visueller Gestaltung hat mich total fasziniert.
Und dieser Traum hat sich erfüllt?
Ja, nach meinem Informatikstudium an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bin ich nach Hamburg gezogen. Dort habe ich sieben Jahre in der Spieleindustrie gearbeitet, vor allem an Browser- und Mobile-Games. Das größte Projekt war „Goodgame Empire“ – ein Strategiespiel mit damals 220 Millionen registrierten Usern weltweit. Das war unglaublich spannend, sowohl technisch als auch organisatorisch.
Wie haben Sie den Übergang vom Studium in die Praxis erlebt?
Interessanterweise ganz anders, als ich es erwartet hatte. Im Studium hatte mich Computergrafik begeistert, ich wollte unbedingt am Client arbeiten. Aber mein erster Job war in der Serverentwicklung – mit Java, einer Sprache, die ich im Studium schrecklich fand. Ausgerechnet das Fach, in dem ich am schlechtesten war – Netzwerke – wurde später zur Grundlage meiner Arbeit. Eigentlich wollte ich den Wechsel Richtung Grafik noch mal probieren, aber es blieb beim Backend. Heute bin ich froh darüber, weil sich daraus meine ganze Laufbahn entwickelt hat.
Sie haben später auch Führungsverantwortung übernommen. Wie kam es dazu?
Relativ schnell. Erst leitender Entwickler, später Teamleiter, Produktmanager, Software-Architekt. Schließlich habe ich in Köln die Abteilungsleitung für rund 30 Entwickler übernommen. Das war spannend, aber irgendwann merkte ich: Ich bin fast nur noch „Mutti für alles“. Das People Management war nicht mehr das, was mich erfüllte.
War das der Punkt, an dem Sie beschlossen haben, sich selbstständig zu machen?
Ja, vor zweieinhalb Jahren. Es gab mehrere Gründe: Zum einen hatte ich das Gefühl, die großen technischen Herausforderungen in meinem damaligen Unternehmen waren gelöst. Zum anderen wollte ich zurück zur Technik. Und drittens hatte ich die Idee, ein eigenes Produkt aufzubauen. Die Selbstständigkeit war für mich eine logische Konsequenz.
Was machen Sie heute genau?
Ich helfe Mittelständlern, ihre Softwareprojekte einfacher und effizienter zu gestalten. Viele Firmen bauen zu komplexe Systeme und verlieren dadurch ihren eigentlichen Business-Mehrwert. Meine Aufgabe ist oft, Komplexität herauszunehmen statt neue Technik einzuführen. Dabei bin ich eine Brücke zwischen Management und Entwicklern.
Haben Sie Ihren heutigen Job also selbst erfunden?
Am Anfang habe ich den Fehler gemacht, alles anzubieten – der klassische Bauchladen. Später habe ich mich auf Performance- Optimierung spezialisiert, weil ich dachte, meine Erfahrung aus der Spieleindustrie sei dafür perfekt. Aber der Markt wollte das nicht. Stattdessen entwickelte sich Schritt für Schritt meine heutige Rolle: Software-Architektur-Reviews, Prozessbegleitung, Beratung. Das ist ein Bedarf, den es tatsächlich gibt – und der für mich passt.
Wir stehen vor einer Umwälzung, die mindestens so tiefgreifend sein wird wie das Internet oder das Smartphone.
Wenn Sie auf die aktuelle Entwicklung blicken: Wie verändert KI die Softwarebranche?
Massiv. Ich glaube, wir stehen vor einer Umwälzung, die mindestens so tiefgreifend sein wird wie das Internet oder das Smartphone. Heute kann ein KI-Agent Fehler im Code finden, reproduzieren und sogar beheben – ohne dass der Entwickler selbst eine Zeile schreibt. Das ist eine völlig neue Arbeitsweise. Für Berufseinsteiger bedeutet das: Viele klassische Einstiegsaufgaben, die früher zum Lernen dienten, erledigt heute die KI.
Das klingt nach einem Problem für junge Entwicklerinnen und Entwickler.
Ja, und das sehen wir bereits: Junior-Positionen sind schwerer zu bekommen, weil Unternehmen weniger Bedarf haben. Gleichzeitig werden erfahrene Entwickler nach wie vor dringend gebraucht – nur: Wenn keine Nachwuchskräfte einsteigen können, fehlt langfristig die Basis. Wir müssen deshalb neue Wege finden, wie Berufseinsteiger lernen können. Vielleicht mehr über Projektarbeit, vielleicht durch gezieltes Mentoring. Aber klar ist: Der alte Weg, über Routinetätigkeiten ins Handwerk hineinzuwachsen, funktioniert so nicht mehr.
Und wie gehen Sie persönlich mit KI um?
Ich teste viel aus. Kürzlich habe ich eine iOS-App von einer KI entwickeln lassen – obwohl ich selbst keine Erfahrung mit iOS hatte. Für mich war das Experiment spannend: Es zeigt, dass mein Job als Architekt sich ändern wird. Künftig schreibe ich nicht nur für Menschen Dokumentationen und Konzepte, sondern auch für Maschinen, die damit arbeiten.
Wenn Sie zurückschauen: Welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben?
Eigentlich keinen großen. Ich bin sehr glücklich, wie es gelaufen ist. Vielleicht nur: Sei offener, auch Dinge zu machen, die du dir nicht vorgenommen hast. Java war nie mein Ziel, aber es hat mich bis heute begleitet. Leidenschaft entsteht oft dadurch, dass man in etwas richtig gut wird – nicht durch die Ideale, die man sich am Anfang setzt.