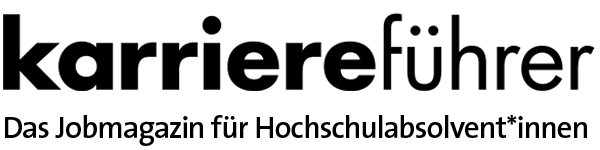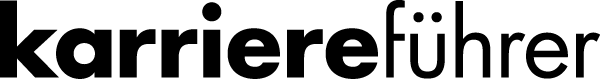- Studiengang Fahrzeugtechnik:
- Studienrichtung: Antrieb und Service
- Studienrichtung: Karosserie und Mechatronik
- Abschluss: Dipl.-Ingenieur (FH)
- Studienzeit: 8 Semester
- Zulassungsbeschränkung
- Studienbeginn: – WS (15.7.): Antrieb und Service – SS (15.1.): Karosserie und Mechatronik
FHT Esslingen: Fahrzeugtechnik
Master “Simultaneous automotive engineering” an der FH Dortmund
Ein bundesweit einmaliger Master-Studiengang der Fahrzeugtechnik startet an der
Fachhochschule Dortmund zum kommenden Wintersemester: “Simultaneous automotive
engineering” heisst das neue Angebot, dass vor allem die Bereiche Entwicklung
und Fertigung zusammenführen soll. Vorsprünge auf diesem Gebiet werden von der
Industrie als entscheidende Wettbewerbsvorteile angesehen. Denn nur, wenn die
Entwickler wissen, was sich technisch und ökonomisch sinnvoll herstellen lässt,
kann beim Automobilbau Zeit und Geld gespart werden.
Die Absolventen sollen im neuen Studienangebot diese wichtigen Qualifikationen
erwerben. Innovationen und immer kürzere Produktzyklen verlangen ein intensives
Zusammenarbeiten aller Disziplinen. Experten schätzen, dass derzeit bis zu einem
Viertel aller wichtiger Ressourcen, wie Personal oder Rohstoffe brachliegen, weil
es noch immer erhebliche Reibungsverluste gibt. Die Entwicklungszeiten müssen
verkürzt, die Produktkosten gesenkt werden. Um dies zu erreichen, sei eine
allgemeine Effizienzsteigerung dringend vonnöten, wie Professor Ulrich Hilger und Professor
Gottfried Hartke, die den neuen Studiengang massgeblich entwickelt haben, betonen.
Teamarbeit ist also angesagt. Ausgezeichnete Berufsaussichten attestiert Professor
Hilger den künftigen Absolventen des neuen Studiengangs: “Die einschlägige
Industrie ist immer auf der Suche nach guten Leuten. Und wer unseren neuen
Masterabschluss erhält, wird gut sein.”
Sowohl bei der Autoindustrie und deren Zulieferern wie auch im klassischen
Maschinenbau werden die neuen “Automobil-Master” gefragt sein. Wichtige
Schlüsselkompetenzen wie Qualitätssicherung und Projektmanagement stehen deshalb ganz
oben auf dem Lehrplan. Automobiltechnisch soll es beispielsweise um alternative
Kraftstoffe wie Erdgas oder Hybridantriebe, also etwa die Kombination von Elektro-
und Benzinmotoren gehen.
Die Fachhochschule stellt zum kommenden Wintersemester 20 Studienplätze zur Verfügung,
die nach einer Vorabauswahl vergeben werden. Zulassungsvoraussetzung ist ein Bachelor-
oder Diplomzeugnis einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin. Mit dem Masterabschluss
ist die Möglichkeit einer Promotion an einer Universitaet verbunden, weshalb auch
fremdsprachliche Qualifikationen in internationalen Projekten wichtige Bestandteile
des Studiums sind. Bewerbungen koennen ab sofort an das Studienbüro der Fachhochschule
gerichtet werden.
Bewerbungen und weitere Infos:
Fon: 0231 9112-110/111
studienbuero@fh-dortmund.de
www.fh-dortmund.de
Quelle: idw, 6.9.04
Mehr Informationen zum Thema Karriere und Bewerbung!
FH Bingen: Maschinenbau, Studienrichtung Kfz-Technik
- Abschluss: Dipl.-Ingenieur (FH)
- Studienzeit: 8 Semester
- keine Zulassungsbeschränkung
- Studienbeginn: WS (15.7.), SS (15.1.)
FH Aachen: Automotive Engineering – Powertrain and Chassis Integration
Der Fachbereich Luft- und Raumfahrt der Fachhochschule Aachen bietet seit dem Sommersemester 2006 den neuen Studiengang: Automotive Engineering – Powertrain and Chassis Integration an.
für den Masterstudiengang gilt:
Regelstudienzeit: 3 Semester (90 Credits) erster Start war im Sommersemester 2006
Bewerbung: vorbehaltlich der Akkreditierung direkt bei der FH Aachen
Studienort: Aachen
Weitere Informationen unter:
http://www.automotive.fh-aachen.de
Mehr Informationen zum Thema Karriere und Bewerbung!
Welfenakademie: Betriebswirtschaft, Studienrichtung Automobilhandel
- Abschluss: Automobil-Kaufmann
- Studienzeit: 6 Semester
- Zulassung nach Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen
- Studienbeginn: WS (Zulassungsbescheid)
Uni Stuttgart: Fahrzeug- und Motorentechnik
Studienrichtung Verbrennungsmotoren
- Abschluss: Dipl.-Ingenieur
- Studienzeit: 9 Semester
- Zulassungsbeschränkung: Hochschulauswahlverfahren
- Studienbeginn: Wintersemester
TU München: Studiengang Maschinenwesen
Studienrichtung Fahrzeug- und Motorentechnik
- Abschluss: Bachelor
- Studienzeit: 6 Semester
- Studienbeginn: WS
TU Ilmenau: Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
- Abschluss: Bachelor of Science oder Master of Science
- Studienzeit: 7 Semester Bachelor of Science bzw. 3 Semester Master of Science
- keine Zulassungsbeschränkung
- Studienbeginn: WS
- Bewerbungszeitraum: vom 1. Mai bis 30. September!
TU Dresden: Verkehrswissenschaften
- Studiengang Verkehrswissenschaften, Studienrichtung Verkehrsingenieurwesen, Verkehrswirtschaft, Verkehrsanlagen oder Fahrzeugtechnik
- Abschluss: Dipl.-Ingenieur
- Studienzeit: 10 Semester
- keine Zulassungsbeschränkung
- Studienbeginn: WS
TU Darmstadt: Maschinenbau, Fachgebiet Fahrzeugtechnik
TU Braunschweig: Maschinenbau, Studienrichtung Kraftfahrzeugtechnik
Der Masterstudiengang Kraftfahrzeugtechnik baut auf den Bachelorstudiengang Maschinenbau bzw. Wirtschaftsingenieurwesen MB auf.
Kontakt:
Studienberatung
Maschinenbau / Bioingenieurwesen / BCPI / Bio-und Chemieingenieurwesen
Christine Jähne
Telefon: + 49 (0)531-391-4013
Institut für Kraftfahrzeugtechnik