Als Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte spricht Angelika Nußberger Urteile mit großer Bedeutung für die Menschen und Staaten Europas. Wie man sich gewissenhaft in neue Themen einarbeitet und warum Juristen heute mehr denn je selbstbewusst ihrer Arbeit nachgehen sollten, erzählt die 48-Jährige im Gespräch. Die Fragen stellte André Boße.
Entsteht im Laufe der Arbeit eine gewisse Routine – oder ist und bleibt jeder Fall eine besondere Sache, die Sie neugierig macht? Ich bin tatsächlich immer neugierig, weil wir es hier in Straßburg mit einem sehr weiten Spektrum an verschiedenen Sachverhalten zu tun haben. Das geht von Fällen der Kindesentführung über Folter in Gefängnissen bis hin zu völkerrechtlichen Fragen. Jede Akte kann etwas ganz Neues beinhalten. Sie lernen also auch als Richterin am Gerichtshof für Menschenrechte jeden Tag etwas hinzu. Ganz bestimmt. Es gibt Länder Europas, mit deren Rechtssystem ich mich nicht sehr gut auskenne, Irland zum Beispiel. Und dann beginne ich zu studieren: Ich informiere mich über die rechtlichen Besonderheiten des jeweiligen Staates und erkunde frühere Urteile des Gerichtshofs zu ähnlichen Problemen, denn wir müssen konsistent entscheiden und auch die Bedeutung der Entscheidung für das jeweilige Land verstehen. Sprich: Nach vielen Jahren als Professorin der Rechtwissenschaft sind Sie nun selber noch einmal eine Einsteigerin. Ja, es ist wieder ein Neuanfang. Jeder Richter hier hat zwar bereits eine lange Karriere in den Rechtswissenschaften hinter sich, wird dann aber am Gerichtshof vor neue Herausforderungen gestellt. Das Recht ist heute so spezialisiert, dass niemand Experte auf allen Gebieten sein kann. Aber was wir Juristen mitbringen müssen, ist die Fähigkeit, uns in neue Problemstellungen einzuarbeiten. Auch wenn ich auf eine Rechtsfrage treffe, zu der ich noch gar nichts weiß, muss ich über die Technik verfügen, mir den Bereich zu erschließen. Ein Einsteiger darf keine Angst davor haben, auf Fragen zu treffen, auf die er ad hoc keine Antwort weiß. Das wird in seiner Karriere immer wieder vorkommen – und er wird lernen, sich die Antwort zu erarbeiten. Viele Kanzleien sind heute international aufgestellt. Kenntnisse in vergleichender Rechtswissenschaft sind wichtig und bieten gute Karrierechancen. Trotzdem wird der Bereich in Deutschland eher stiefmütterlich behandelt. Warum ist das so? Die Beobachtung stimmt. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass das deutsche Rechtssystem sehr ausgefeilt ist. Viele Juristen denken daher schon an der Uni: Ich muss so viel über das eigene Recht wissen, dass ich die anderen Länder erst einmal weniger beachte. Aber mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen ist es sehr ratsam, sich hier stärker zu öffnen. Sie haben sich früh in Ihrer Karriere auf das Recht osteuropäischer Staaten konzentriert. Warum dieser Fokus? Die Umbrüche, die diese Länder erlebt haben, waren enorm. Viele Staaten mussten vom Eigentumsbegriff bis zu den Grundrechten alles komplett neu erfinden, und es war für mich sehr spannend, mich mit Rechtssystemen zu befassen, die sich gerade im Aufbau befanden. Ein Punkt war aber auch, dass ich es eine besondere Herausforderung fand, einen Weg zu gehen, den nicht alle gehen. Eine Entscheidung, die Ihrer Karriere schon sehr früh einen Schub gab. Ja, wobei ich tatsächlich das historische Glück hatte, dass ich mein Studium begann, als die Umbrüche noch gar nicht zu erkennen waren, und es abschloss, als gerade die Grenzen aufgingen. Sie haben 1994 und 1995 ein Forschungsjahr in Harvard verbracht. Der Name ist schillernd – haben Sie von dort etwas mitgebracht, was Ihrer Karriere bis heute nützt? Es muss nicht unbedingt Harvard sein. Ich würde rückblickend sogar sagen, dass meine Russlandaufenthalte Mitte, Ende der 80er-Jahre für mich noch prägender waren. Dort habe ich mit meinen eigenen Augen eine gesellschaftliche Wirklichkeit gesehen, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte – während ich von Harvard eine ganz gute Vorstellung hatte, da gab es nicht so viel völlig Neues und Überraschendes. Als Richterin in Straßburg sprechen Sie mit Ihren Urteilen für rund 800 Millionen Europäer, nicht selten haben Ihre Urteile Auswirkungen auf Staatsverfassungen. Wie gehen Sie mit den Erwartungen an Ihre Arbeit um? Ich weiß, wie unsere Urteile rezipiert werden und wie sie das Leben der Menschen beeinflussen können. Ich fühle die Verantwortung und arbeite daran, dass jedes Urteil unmittelbar einleuchtet und dem hohen Standard entspricht, den das Gericht sich selbst gesetzt hat. Wir müssen sehr gut Argumentieren und die Menschen von unseren Urteilen überzeugen – sonst haben wir ein Legitimationsproblem. Das Gute ist, dass ich hier nicht alleine bin: Ich arbeite im Team mit 46 anderen Richtern, da verteilt sich die Last. Zuletzt gab es in Deutschland von Seiten der Medien Kritik an richterlichen Urteilen. Müssen sich Juristen am Beginn ihrer Karriere darauf einstellen, dass sie heute verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit stehen? Der Umgang der Medien mit der Justiz hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich sehe das durchaus als problematisch, weil dadurch vor und nach der Urteilsverkündung ein großer Druck aufgebaut wird. Sachliche Kritik an Urteilen ist in Ordnung. Schwierig wird es aber, wenn die Kritik ideologisiert, polarisiert oder die Autorität des Gerichts missachtet. Wobei einige Rechts- und Staatsanwälte das Spiel bereitwillig mitspielen. Muss ein Einsteiger heute die Regeln dieses Spiels beherrschen, um Karriere zu machen? Juristen sind keine Politiker. Sie müssen keine Wählerstimmen sammeln, sondern einfach nur das Recht anwenden. Schon Einsteiger sollten hier Selbstvertrauen mitbringen und sich sagen: Was immer die anderen sagen mögen – ich versuche hier und jetzt, meine Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen und mich von allen Formen des Drucks von außen freizuhalten. Natürlich ist es wichtig, als Jurist gut vortragen und sprechen zu können. Aber ich finde, dass es von noch größerer Bedeutung ist, das juristische Handwerkszeug gut erlernt zu haben und einsetzen zu können. Denn wer als Jurist keine Fehler macht, der gibt sich auch keine Blöße.Zur Person
Angelika Nußberger, 48 Jahre, studierte von 1984 bis 1989 Rechtswissenschaft in München; schon 1987 hatte sie dort ihr Studium der Slawistik abgeschlossen. Ihr Zweites Juristisches Staatsexamen legte sie 1993 in Heidelberg ab, später promovierte sie in Würzburg über das sowjetische Verfassungsrecht in den Umbruchsjahren. Ihre berufliche Karriere begann sie 1993 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Sozialrecht. Von 2001 bis 2002 ging sie als Rechtsberaterin im Europarat nach Straßburg und wurde danach zur Professorin der Rechtswissenschaft an die Uni Köln berufen. Ab 2009 war sie Prorektorin der Uni und leitete unter anderem das Rektorat für akademische Karriere. Im Juni 2010 wählte die Parlamentarische Versammlung des Europarats sie zur Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Angelika Nußberger trat die Stelle zum Jahresbeginn 2011 als Nachfolgerin von Renate Jaeger an.
Zum Unternehmen
Als 1953 die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft trat, erhielt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Funktion, als Gericht die Einhaltung der Menschenrechte in den Unterzeichnerstaaten zu garantieren. Zu seiner ersten Sitzung kam der Gerichtshof 1959 zusammen, damals gehörten ihm 15 Richter an – pro Unterzeichnerland einer. Diese Regelung wird bis heute beibehalten, wobei sich die Zahl der Richter auf 47 erhöht hat. Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Rechte wie zum Beispiel das Folterverbot, den Schutz des Eigentums oder das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Da sich jeder Bürger Europas beim Gerichtshof beschweren kann, wenn er glaubt, ein Staat verstoße gegen die Menschenrechtskonvention, hat die Institution eine Flut von Fällen zu behandeln. Derzeit sind es rund 150.000 – viele von ihnen stellen sich am Ende als unzulässig heraus und werden nach einer Prüfung aus dem Verfahrensregister gestrichen. Interview mit Prof. Dr. Dr. h.c. Angelika Nußberger M.A. als PDF ansehen
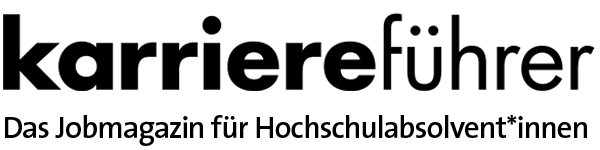
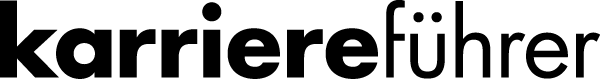




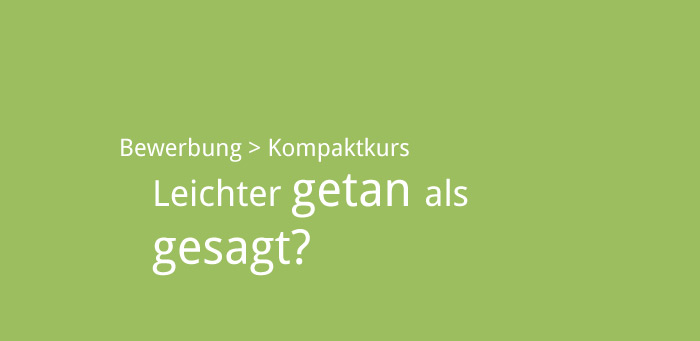




 Martin John Yate hält Karriere-Seminare in den USA, Canada, Mexico, UK, Australien, Neuseeland und Afrika. Sein Buch Buch: “Knock ‘em Dead” wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und ist seit Jahren ein internationaler Bestseller. In Deutschland ist es unter dem Titel “Das erfolgreiche Bewerbungsgespräch” erschienen. Sein Motto: “One simple rule I have in writing: there has to be something practical on every page that every reader can put to work for their benefit today.”
Martin John Yate hält Karriere-Seminare in den USA, Canada, Mexico, UK, Australien, Neuseeland und Afrika. Sein Buch Buch: “Knock ‘em Dead” wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und ist seit Jahren ein internationaler Bestseller. In Deutschland ist es unter dem Titel “Das erfolgreiche Bewerbungsgespräch” erschienen. Sein Motto: “One simple rule I have in writing: there has to be something practical on every page that every reader can put to work for their benefit today.” Sie haben noch nie auf eine Online-Stellenanzeige reagiert? Nur keine Angst! Online- Stellenangebote sind meist mit einem Bewerber-Managementsystem verknüpft. Wer den Button “Online bewerben” anklickt, gelangt automatisch in dieses System und wird dann durch das Programm geführt. Das heißt, eigentlich muss der Bewerber nur noch tun, was das System ihm sagt. In der Regel werden zunächst die persönlichen Angaben abgefragt: Name, Adresse, Alter. Dann folgen Fragen zur Schulbildung, zum Studium, zu Praktika, Berufsausbildung, Berufstätigkeit und fachlichen Kompetenzen. Unter dem Stichwort “formale Angaben” geht es dann um den möglichen Eintrittstermin und die Gehaltsvorstellung. Schließlich hat der Bewerber die Möglichkeit, Dokumente in das System hochzuladen. Das kann ein individuell auf den Arbeitgeber zugeschnittenes Anschreiben sein, ein Lebenslauf mit integriertem Foto, gescannte Zeugnisse und Urkunden. Unternehmen machen meist deutlich, was ihnen wichtig ist. Häufig gibt das System außerdem eine Obergrenze für die Datenmenge an, die hochgeladen werden kann. Schließlich wird die gesamte Bewerbung per Knopfdruck an das Unternehmen abgeschickt.
Bevor Sie sich für die Online-Bewerbung entscheiden, sollten Sie sich jedoch mit den Besonderheiten auseinandersetzen. Ob eine Online-Bewerbung sinnvoll ist, sollten Sie jeweils im Einzelfall entscheiden. Um Ihnen einen Einblick in die Interessenslage der Unternehmen zu geben, erfahren Sie im Folgenden ausgewählte Beweggründe für die Einführung von Online-Bewerbungen aus Sicht von Unternehmen:
Sie haben noch nie auf eine Online-Stellenanzeige reagiert? Nur keine Angst! Online- Stellenangebote sind meist mit einem Bewerber-Managementsystem verknüpft. Wer den Button “Online bewerben” anklickt, gelangt automatisch in dieses System und wird dann durch das Programm geführt. Das heißt, eigentlich muss der Bewerber nur noch tun, was das System ihm sagt. In der Regel werden zunächst die persönlichen Angaben abgefragt: Name, Adresse, Alter. Dann folgen Fragen zur Schulbildung, zum Studium, zu Praktika, Berufsausbildung, Berufstätigkeit und fachlichen Kompetenzen. Unter dem Stichwort “formale Angaben” geht es dann um den möglichen Eintrittstermin und die Gehaltsvorstellung. Schließlich hat der Bewerber die Möglichkeit, Dokumente in das System hochzuladen. Das kann ein individuell auf den Arbeitgeber zugeschnittenes Anschreiben sein, ein Lebenslauf mit integriertem Foto, gescannte Zeugnisse und Urkunden. Unternehmen machen meist deutlich, was ihnen wichtig ist. Häufig gibt das System außerdem eine Obergrenze für die Datenmenge an, die hochgeladen werden kann. Schließlich wird die gesamte Bewerbung per Knopfdruck an das Unternehmen abgeschickt.
Bevor Sie sich für die Online-Bewerbung entscheiden, sollten Sie sich jedoch mit den Besonderheiten auseinandersetzen. Ob eine Online-Bewerbung sinnvoll ist, sollten Sie jeweils im Einzelfall entscheiden. Um Ihnen einen Einblick in die Interessenslage der Unternehmen zu geben, erfahren Sie im Folgenden ausgewählte Beweggründe für die Einführung von Online-Bewerbungen aus Sicht von Unternehmen:


