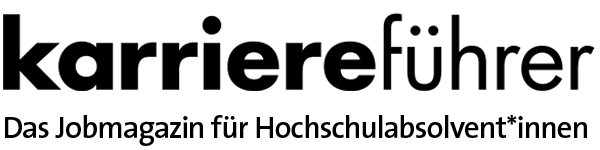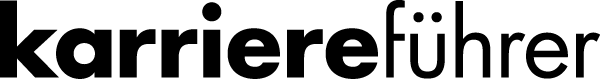Raphael von Hoensbroech war auf dem besten Weg, ein bedeutender Dirigent zu werden. Doch den studierten Musikwissenschaftler lockte eine Karriere in der Unternehmensberatung, sodass er bei der Boston Consulting Group einstieg. Als geschäftsführender Direktor des Konzerthauses Berlin verbindet er nun beide Seiten: Musik und Wirtschaft. Im Interview erinnert er sich an sein Exotendasein als Consultant und definiert, was einen guten Berater auszeichnet. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Dr. Raphael von Hoensbroech wurde 1977 in Tokio geboren. Er studierte Musikwissenschaft, Philosophie sowie Schuld- und Urheberrecht und promovierte über „Felix Mendelssohn Bartholdys unvollendetes Oratorium Christus“. Neben dem Studium bildete er sich zum Dirigenten aus. Von 2005 bis 2013 arbeitete er als Unternehmensberater für die Boston Consulting Group, wo er sich zuletzt auf die Beratung von kulturellen und sozialen Organisationen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors spezialisierte. Für Unternehmen entwickelte er unter anderem einen Orchester-Workshop, der das Thema Führen aus der Perspektive des Dirigenten beleuchtet. Seit 2013 ist er geschäftsführender Direktor des Konzerthauses Berlin.
Herr Dr. von Hoensbroech, Sie sind als studierter Musikwissenschaftler und Dirigent als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group (BCG) eingestiegen. Damit sind Sie ein typischer Quereinsteiger. Haben Sie sich auch so gefühlt?
Durchaus, ja. 50 Prozent der Berater bei BCG sind keine BWLer, aber die wahren Exoten machen eher rund 20 Prozent aus. Mit diesen Kollegen aus Fachrichtungen wie Philosophie, Medizin oder Theologie habe ich 2005 gemeinsam mit einem Exoten-Training angefangen.
Heißt das offiziell so?
Heute nicht mehr, weil es einem einen Stempel aufdrückt. Damals aber schon, ja. Wir Exoten haben in der Gruppe ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelt. Wir waren alle neu in der Welt der Privatwirtschaft.
Wie haben Sie das wahrgenommen?
Nicht negativ. Ich habe erfahren, dass es spannend ist, unterschiedliche Disziplinen zusammenzuführen und gemeinsam an Lösungsstrategien zu arbeiten. Und mir wurde auch von den BWLern zurückgespiegelt, dass sie es erfrischend fanden, wenn wir Exoten mit in den Teams waren.
Sind Sie dementsprechend selbstbewusst aufgetreten?
Zunächst einmal nicht, da man schon denkt: „Wann werden sie wohl merken, dass ich ein Recruitingfehler bin?“
Haben Sie versucht, sich anzupassen?
Nein, und das halte ich auch für falsch. Ich kann nur die Sprache sprechen, die ich beherrsche. Daher sollte man unbedingt authentisch bleiben, anstatt eine Rolle einzunehmen, die nicht der eigenen Persönlichkeit entspricht. Der Berater wird nicht dadurch besser oder glaubwürdiger, indem er so tut, als sei er Berater, und sich ständig bemüht, diese Rolle zu spielen. Schließlich ist es so: Der Kunde, zu dem man als Einsteiger geschickt wird, vertraut in diesem Moment nicht mir, sondern dem Beratungsunternehmen. Und da dieses Beratungsunternehmen mich eingestellt hat, geht das Vertrauen des Kunden als Vorschuss auf mich über.
Was sind die Erinnerungen an Ihr erstes Projekt?
Die Teamleiterin war auch eine Exotin, was mir natürlich half. Es ging um eine Umstrukturierung, wobei ich eine koordinative, vermittelnde Rolle innehatte. Meine Aufgabe war also nicht die Erstellung großer Excel-Rechenmodelle, für meine Arbeit brauchte ich vor allem gesunden Menschenverstand und Kommunikationstalent.
Und wer ein Orchester dirigieren kann, bekommt auch die Arbeit im Bereich Personal hin.
So hat man wohl gedacht, ja. Wobei ich der Ansicht bin, dass Beratung immer zu gleichen Teilen eine fachlich inhaltliche sowie eine kommunikative Dimension hat. Der zweite Aspekt wird manchmal vernachlässigt, was dazu führt, dass Projekte nicht zufriedenstellend zu Ende geführt werden. Lösungen werden häufig zu Ende gedacht, jedoch nicht zu Ende kommuniziert.
Sie haben im Laufe Ihrer BCG-Jahre sicherlich einiges über Unternehmen gelernt. Welche Erkenntnis ist die wertvollste?
Wer Bälle in die Luft wirft, sollte auch in der Lage sein, sie wieder aufzufangen. Ich habe häufig erlebt, dass Vorstände oder Geschäftsleitungen mit viel Schwung Bälle geworfen haben, aber es war keiner da, der diese Impulse operativ in konkrete Ergebnisse umsetzen konnte. Zum Beispiel, weil Ziele nicht hinreichend kommuniziert wurden. Oder Verantwortlichkeiten nicht geklärt waren.
Sie leiten jetzt die Geschäfte des Berliner Konzerthauses, dort waren Sie ja auch als Berater tätig, bei einem Pro-bono-Projekt der BCG. Wie haben Sie damals Ihren jetzigen Arbeitgeber bewertet?
Es ist zunächst einmal eines der schönsten Konzerthäuser Europas. Es verfügt über ein eigenes Spitzenorchester, mit dem man ein Programm gestalten, aber auch Experimente wagen kann. Und es gibt ein Team, das bereit ist, neue Wege zu gehen. Es ist der Kunst verpflichtet, denkt aber auch betriebswirtschaftlich.
Kann das überhaupt funktionieren?
Es handelt sich tatsächlich um einen Ziele-Dualismus.
Ein schöner Euphemismus für Konfliktpotenzial …
… wobei wir diese Situation tatsächlich eher als Geschenk empfinden. Wir haben klare Kennzahlen: die Auslastung des Hauses und die finanzielle Situation. Wir dürfen aber auch einen künstlerischen Auftrag erfüllen, schon um dem Subventionsgeber gerecht zu werden. Der Weg muss sein, dass lukrative Veranstaltungen einige ambitionierte Konzerte querfinanzieren.
Vermissen Sie eine solche Denkweise in Unternehmen?
Dass Unternehmen häufig nur kurzfristig an den Shareholder Value denken, geht manchmal auf Kosten des langfristigen Erfolgs und der Motivation der Teams. Mir gefällt im Konzerthaus die Idee, dass wir durch künstlerisch wertvolle Konzerte auch dann die Organisation stärken, wenn die Auslastung nicht so hoch ist. Natürlich müssen wir als Gegenpol Konzerte machen, die sich rechnen. Aber die Lust, auch mal neue, ungewohnte Wege zu gehen, oder die Erfüllung höherer Ziele wird einem hier nicht durch kommerzielle Pflichterfüllung zu jeder Zeit genommen. Ich habe einige Unternehmen kennengelernt, die genauso arbeiten, und glaube, dass sie nicht schlecht damit fahren. Es stärkt nebenbei das Vertrauen der Kunden. Und das ist natürlich auch unser Ziel: Unser Publikum soll uns letztlich vertrauen können, dass sich der Konzertbesuch lohnt, egal was auf dem Programmzettel steht.
Zum Konzerthaus Berlin
Das Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt bietet ein breites Programm mit Sinfoniekonzerten und Kammermusik, Musiktheaterproduktionen und speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie aus Alter und Neuer Musik. Das hauseigene Konzerthausorchester wird seit der Saison 2012/13 vom Chefdirigenten Iván Fischer geleitet und bestreitet mit fast 100 Konzerten pro Saison einen großen Teil der rund 600 Veranstaltungen pro Jahr. Intendant des Konzerthauses ist seit 2009 Prof. Dr. Sebastian Nordmann, der wie von Hoensbroech einige Zeit als Unternehmensberater tätig war. Besonderen Fokus legen sie auf die Umsetzung neuer Konzertformate, um klassische Musik auch einem neuen Publikum nahezubringen. Dazu zählen öffentliche Proben, kurze „Espresso-Konzerte“ am Nachmittag oder die Reihe „Mittendrin“, bei der das Publikum mitten im Orchester Platz findet.