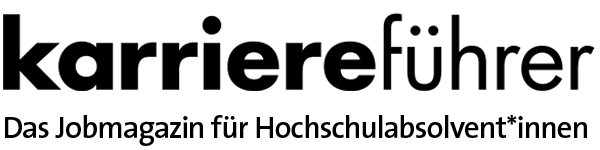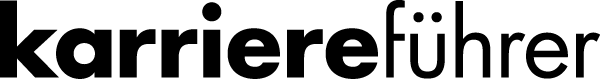Weil er sich lieber mit Menschen als mit Paragrafen beschäftigte, starte der promovierte Jurist und Diplom-Psychologe Bertold Ulsamer eine Karriere als Therapeut. Doch Themen wie Schuld und Gerechtigkeit beschäftigen ihn auch weiter: Sein neues Buch behandelt die „Acht Gesichter der Schuld“. Interview: André Boße
Zur Person
Dr. Bertold Ulsamer, geboren 1948 in Haßfurt, studierte in Würzburg, Genf und Freiburg von 1969 bis 1978 Jura und Psychologie. Er beendete das Jurastudium mit der Promotion zum Dr. jur. und dem Zweiten Staatsexamen, das Psychologiestudium mit dem Diplom in Klinischer Psychologie. Er gründete 1984 ein Institut für Managementtraining, seit Mitte der 1990er-Jahre ist er hauptsächlich als Psycho- und Familientherapeut tätig. Zudem ist er Autor mehrerer Fachbücher, zuletzt erschien von ihm „Acht Gesichter der Schuld. Ansätze zur Überwindung“ (Scorpio Verlag 2015. ISBN 978-3958030022. 17,99 Euro).
Herr Ulsamer, warum sind Sie als promovierter Jurist Psychologe geworden?
Ich habe in der zweiten Hälfte meines Studiums sowie in meiner Zeit als Referendar gemerkt, dass ich lieber mit Menschen arbeiten möchte als mit Paragrafen. Ich war damals zum Beispiel im Verwaltungsrecht nicht so gut wie im Strafrecht. Ich habe mich dann gefragt, woran das liegt, und gemerkt, dass ich bei verwaltungsrechtlichen Fragen grundsätzlich auf der Seite der Bürger stand. Ich habe menschlich argumentiert, jedoch aus juristischer Sicht nicht sehr überzeugend. Vollblutjuristen müssen besser abstrahieren können. Daher bin ich schließlich lieber ganz in die Psychologie gegangen.
Gibt es Inhalte aus Ihrem Jura-Studium, die Sie für Ihre Arbeit bis heute gut gebrauchen können? Ist etwas hängengeblieben?
Ich glaube, dass ich deshalb strukturierter denke und argumentiere. Ich kann meine Begründungen gut vermitteln, so dass sie nachvollziehbar sind. Scheinbar hat mir das strukturierte Arbeiten während des Jurastudiums also gut getan. (lacht)
Ihr neues Buch behandelt den psychologisch und juristisch sehr komplexen Begriff der Schuld. Welche Arten der Schuld gibt es?
Es gibt viele Formen, in meinem Buch unterscheide ich acht. Da ist zunächst einmal das Schuldgefühl, wenn ein Mensch tief in sich drinnen weiß, dass er einem anderen Leid zugefügt hat. Da geht es auch um die klassische juristische Schuld eines Täters. Eine zweite Form von Schuld entsteht im Kopf eines Menschen, wo eine eigene Instanz das Verhalten verurteilt. Das führt zum schlechten Gewissen. Das kann mit einer juristischen Schuld zusammenhängen, muss es aber nicht, denn das schlechte Gewissen entsteht auch, wenn ich mir vornehme, abends keine Schokolade mehr zu essen, dies aber doch tue. Oder wenn ich zu viel oder zu wenig arbeite. Eine dritte Form von Schuld ist eine Gegenreaktion zur Hilflosigkeit bei schlimmen Ereignissen. Man glaubt, die Geschehnisse in den Griff zu bekommen, wenn man einen Schuldigen findet. Zum Beispiel bei Unglücksfällen, Katastrophen oder auch schrecklichen Verbrechen.
Hat ein Schuldgefühl etwas mit Empathie zu tun?
Man kann es Empathie nennen, ja. Die Forschung hat aber auch die Spiegelneuronen entdeckt, die einen Menschen erfahren lassen, wie es dem anderen gerade geht. Menschen mit Empathie möchten nicht, dass es dem anderen schlecht geht. Also rechtfertigen sie ihr Handeln, suchen nach Ausreden, versuchen, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Oder das Handeln, das den anderen verletzt hat, rational zu erklären. Das passiert in der Erziehung ganz häufig: Eltern entschuldigen ihre Strenge damit, dass sie es ja nur gut fürs Kind meinen. Im beruflichen Alltag erleben wir häufig, dass Menschen behaupten, sie hätten diese oder jene Entscheidung zum Wohle des Unternehmens getroffen. Das stimmt sicherlich. Und trotzdem – gleichzeitig – ist ihr Handeln mit Schuld verbunden. Schuld ist so im menschlichen Leben oft unvermeidbar. Es ist daher schon ein großer Schritt, wenn jemand zugibt: Ja, ich habe den anderen verletzt. Ich schaue ihm tief in die Augen und kann dann erkennen, wie es ihm gerade geht.
Ist es für Juristen eine wichtige Aufgabe, den anderen dazu zu bringen, empathisch zu sein? Seine Schuld zu erkennen?
Nicht für alle Bereiche, aber im Strafvollzug ist das ein großes Thema. Wer mit Inhaftierten spricht und ihnen helfen will, sollte versuchen, bei diesen Menschen das Gefühl zu wecken, zu erkennen, wie es den Menschen geht, denen sie durch ihre Tat Leid zugefügt haben. Es ist wichtig, dass der Verurteilte zu seiner Tat steht.
Gibt es Tricks, diese Empathie bei anderen zu wecken?
Wichtig ist, dass ich selbst Empathie mitbringe. Ich muss zum Beispiel erkennen, wie es dem Täter geht, was er gerade durchmacht. Wenn ich ihn moralisch verurteile, macht er natürlich dicht. Je weniger ich einen Schuldigen angreife, desto mehr Möglichkeiten gebe ich ihm, seine eigene Schuld nachzuvollziehen. Das ist ein Prozess, den man von außen anstoßen kann. Erzwingen kann man ihn nicht.
Kann der Gerichtssaal der Ort sein, an dem Schuld nicht nur festgestellt wird, sondern auch tatsächlich vergeben werden kann?
Nein, das passiert nur in Ausnahmefällen. Vor Gericht geht es um Gerechtigkeit und Bestrafung – nicht um Versöhnung. Daher dreht sich in einem normalen Strafprozess alles um den Angeklagten, also den mutmaßlichen Täter. Um die Opfer kümmert sich das Gericht nur am Rande. Ich halte daher den Täter-Opfer-Ausgleich für ein sinnvolles und wertvolles Instrument, um sich wirklich mit den Themen Schuld und Vergebung zu beschäftigen. Hier wird das Opfer viel stärker einbezogen. Es kommt zu einer Interaktion zwischen Täter und Opfer – und damit zu einer viel intensiveren Auseinandersetzung mit der Schuldfrage.
Aber ein Schuldspruch mit einer knackigen Geld- oder Gefängnisstrafe hilft dem Opfer doch auch, oder?
Vielleicht kurzfristig. Befriedigt wird hier aber nur das Rachegefühl. Das ist eine Genugtuung, ohne Frage. Aber diese Befriedigung geht schnell vorbei, weil das Opfer merkt, dass es persönlich nicht davon profitiert, wenn der andere hart bestraft wird.
Zum Abschluss: Ist es für einen jungen Juristen wichtig, psychologisches Wissen mitzubringen?
Es ist wichtig. Doch die Psychologie ist zweischneidig. Es gibt das theoretische, akademische Wissen, das einem Juristen eher wenig bringt. Die Themen sind einfach zu abstrakt, um sie in den beruflichen Alltag auf den konkreten Menschen zu transferieren. Es gibt allerdings eine Alltagspsychologie, man könnte sie auch mit dem Begriff der Menschenkenntnis beschreiben. Zu wissen, wie ich mit Menschen umgehen sollte und wie ich mich selbst als Mensch erfahre, ist auch für Juristen sehr wichtig. Dafür muss ich aber nicht unbedingt Psychologie studieren. Der Weg führt dahin, wenn ich achtsam gegenüber anderen bin, mich immer wieder austausche und selbst reflektiere.