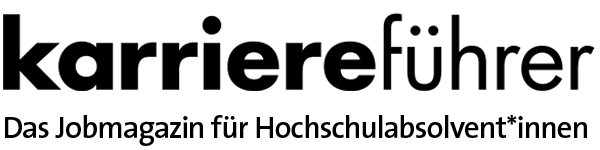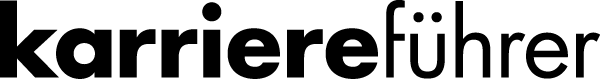Als wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie beschäftigt sich Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick mit der Frage, wie sich die Transformation in eine nachhaltigere Welt gestalten lässt. Eine Schlüsselposition nehmen dabei die Ingenieur*innen mit ihrer technischen Lösungskompetenz ein. Denn ohne diese würde die Umsetzung der Konzepte nicht funktionieren. Die Fragen stellte André Boße
Zur Person
Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick studierte Chemie- und Verfahrenstechnik an der Uni Dortmund und promovierte in Stuttgart im Bereich der Energietechnik und Energiewirtschaft. 1993 kam er ans Wuppertal Institut, wo er bis 2006 in verschiedenen Positionen tätig war und unter anderem die Forschungsgruppe „Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen“ leitete. Ab 2006 war er Vizepräsident des Instituts, seit 2008 ist er außerplanmäßiger Professor des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften – Schumpeter School of Business and Economics an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Januar 2020 übernahm Fischedick den Posten als wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts. Er berät die Europäische Union, die Bundes- und die Landesregierung, ist Mitglied in vielen wissenschaftlichen Gremien und Leitautor im Weltklimarat.
Herr Prof. Fischedick, ich habe auf YouTube ein elf Jahre altes Video- Interview gefunden, aufgenommen kurz nach den Ereignissen in Fukushima. Ihre Aussage damals, sinngemäß: Jetzt beginnt sie, die Transformation der Energieversorgung. Wie sieht heute Ihr Fazit aus: Startete damals tatsächlich die Energiewende?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich würde aber schon sagen, dass der Transformationsprozess damals startete, weil 2011 wegweisende politische Entscheidungen getroffen wurden. Es gab die Ausstiegsbeschlüsse aus der Atomkraft. Unter dem Druck, handeln zu müssen, wurde mehr oder weniger über Nacht nicht nur die Vorstellung der damaligen Regierung einer Laufzeitverlängerung fallengelassen, sondern ein klarer Fahrplan für die Stilllegung der Kernkraftwerke fest vorgegeben. Hiermit wurde nicht nur Risikovorsorge getroffen, sondern ein lange schwelender Grundsatzkonflikt in der Energiepolitik befriedet. Dazu hatte Deutschland damals bereits vergleichsweise ambitionierte Klimaziele formuliert: Es ging 2011 zwar noch nicht um Treibhausgasneutralität, also nicht um eine Minderung von 100 Prozent, aber immerhin schon um 80 Prozent. Entscheidend war nun, dass diese Ziele vor dem Hintergrund des Atomausstiegs nicht aufgeweicht worden sind, das war eine gute Entwicklung.
Wo hat es gehakt?
Es hätte zum Beispiel einen gesellschaftlichen Diskurs darüber gebraucht, welche Art von Energie man statt Kohle, die aus Klimaschutzgründen schon damals als Auslaufmodell feststand, und statt Atom haben möchte. Diese Debatte hat in der Breite und mit der notwendigen Ehrlichkeit nicht stattgefunden. Man hat das Thema eher laufenlassen, nach dem Motto: „Es ist ausreichend, Ziele zu setzen – der Rest findet sich schon.“
Tat er aber nicht.
Genau. Zwar sind wir bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien zumindest im Bereich der Stromerzeugung substanziell vorangekommen, beim Thema Energieeffizienz ist das aber nicht der Fall. Kurz: Man hat sich hohe Ziele gesetzt, es aber an Steuerungsinstrumenten vermissen lassen, um diese auch zu erreichen.
Sie sprachen vom Druck, handeln zu müssen: Vor elf Jahren hat Fukushima die Energiewende eingeleitet, jetzt sorgen der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine und seine Folgen dafür, dass die Frage nach einer nachhaltigen Energie eine ganz neue Dynamik erhält. Warum brauchen wir immer den Schock, um ins Handeln zu kommen?
Die Menschen und auch die Politik reagieren im Normalfall besonders stark auf unmittelbare Gefährdung. Ein Atom-GAU war eine solche, wobei die Katastrophe in Fukushima recht schnell wieder in Vergessenheit geriet, weil der Mensch dazu neigt, Gefahren, die nicht mehr unmittelbar sind, zu verdrängen. Der Krieg auf europäischem Boden ist nun aber eine neue unmittelbare Gefährdung. Es wird offenkundig, dass sich energiepolitische Gewissheiten, die über Jahrzehnte Gültigkeit hatten, plötzlich auflösen.
Und der Klimawandel?
Der ist in der Wahrnehmung vieler noch keine unmittelbare Gefährdung in der Breite. Dies scheint sich aber gerade zu ändern, nicht zuletzt aufgrund der Starkregenfälle im vergangenen Jahr und der Dürre und Hitze in diesem Sommer. Die Waldbrände finden nicht mehr nur wie üblich in den USA oder in Australien statt, sondern in Italien und Frankreich, also dort, wo wir Urlaub machen. Sie sind aber auch in Brandenburg, verbunden mit sinkenden Grundwasserspiegeln und Flüssen mit historischem Niedrigwasser. Ich denke schon, dass diese Unmittelbarkeit zum entscheidenden Booster für den Klimaschutz werden wird. Dies gilt auch für die Lehren, die wir aus dem Krieg in der Ukraine ziehen müssen. Die Vorteile liegen ja auf der Hand: Jede Form von erneuerbarer Energie und Energieeffizienz stärkt nicht nur den Klimaschutz, sondern ist auch ein Schritt in eine verbesserte Versorgungssicherheit und in Richtung Unabhängigkeit von anderen Staaten.
Ich muss mich fragen, ob eine Lösung, die ich entwickelt habe, an anderer Stelle zu negativen Folgen führen kann.
Was muss passieren, damit der Booster zündet?
Neben der bereits erwähnten gesellschaftspolitischen Debatte liegt ein großes Problem in den langen Planungsund Genehmigungszeiten und in fehlender vorausschauender Planung. Nehmen Sie die Flüssiggas-Terminals, die gerade entstehen: Es wäre sehr sinnvoll, sie so zu konstruieren, dass sie später problemlos zu Wasserstoff-Terminals umgebaut werden können. Das Flüssiggas brauchen wir jetzt, aber Wasserstoff ist die Energieform der Zukunft, hierfür müssen wir die Grundlagen schaffen. Was wir also jetzt brauchen, ist kein Aktionismus, sondern einen systemischen Wandel.
Welche Rolle können Ingenieurinnen und Ingenieure hier spielen?
Es gibt in meinen Augen vier Akteursgruppen, die jetzt eine entscheidende Rolle einnehmen und die Transformationsprozesse voranbringen. Es braucht mutige politische Entscheidungsträger, die trotz aller Unsicherheiten ganz klare Vorgaben machen und notwendige Konditionen formulieren, so wie das Beispiel von gerade: Flüsiggas-Terminals ja, aber nur, wenn sie in einigen Jahren auch fit für Wasserstoff sein werden. Gefordert ist auch die Wissenschaft, um Konzepte und Lösungsstrategien zu entwickeln. Die Welt mit ihren Herausforderungen ist komplexer geworden, Wissenschaft kann hier helfen, Orientierungswissen bereitzustellen. Dann geht es auf die Umsetzungsebene, wo es zunächst einmal auf das Handwerk ankommt: Wir sehen schon jetzt, dass die Fachkräfte fehlen, um die Lösungen, die es bereits gibt, auch in der Breite umzusetzen, zum Beispiel im Bereich der Heizungssysteme oder Gebäudesanierungen. Gefragt sind aber natürlich auch und gerade die Ingenieure, denn sie besitzen die für die komplexe Gemengelage wichtige Lösungskompetenz. Es braucht heute mehr und mehr sektorübergreifende Systemlösungen, das ist ebenso eine Herausforderung, der sich Ingenieure stellen müssen, wie etwa der Umgang mit immer mehr radikalen statt primär inkrementellen Verbesserungen.
Was bedeutet das konkret?
Es kommt darauf an, das große Ganze im Blick zu haben und Wechselwirkungen mitzudenken. Das heißt, sich zum Beispiel zu fragen, ob eine Lösung, die ich entwickelt habe, an anderer Stelle zu negativen Folgen führen kann. Oder wie es gelingen kann, mit einer technischen Lösung zwei, drei positive Synergieeffekte zu gestalten. Auf diese Systemlösungskompetenz kommt es bei Ingenieuren heute mehr denn je an. Zusammen mit dem Handwerk ist das Ingenieurwesen der Berufszweig, der uns als Gesellschaft überhaupt die Chance gibt, die Erkenntnisse der Wissenschaft sowie die Entscheidungen der Politik umzusetzen. Auf neudeutsch würde man sagen: Handwerk und Ingenieurwesen sind die Enabler der Energiewende.
Es braucht eine gehörige Portion Pioniergeist, denn für die Transformationsprozesse, in denen wir uns befinden, existieren keine Blaupausen.
Ist diese Lösungskompetenz der Ingenieurinnen und Ingenieure in Ihren Augen gegeben?
Es gibt da schon einen gewissen Nachholbedarf. Was an vielen Universitäten noch fehlt, ist die Beschreibung der breiteren Landschaft. Neue Techniken betten sich in Landschaften ein, die sich außerordentlich schnell verändern, zum Beispiel durch die Digitalisierung, einen der Megatrends der Gegenwart. Oder durch Konsumtrends wie Vegetarismus oder Veganismus sowie nachhaltiges Shoppingverhalten. Oder auch durch die vielen Risikofaktoren, die sich kaum im Vorfeld bestimmen lassen. Nehmen Sie den Krieg in der Ukraine: Er dreht die Welt mal eben von links auf rechts. Ich denke, es ist in vielen Ingenieurstudiengängen noch nicht genügend angekommen, dass sich die Lösungen heute in einem sich sehr schnell verändernden Umfeld bewähren müssen. Und noch ein zweiter Punkt ist wichtig: Ingenieure arbeiten heute an Embedded Technologies, also Technologien, die nicht nur in den ökonomischen Rahmen eingebettet sind, sondern auch in den politischen, gesellschaftlichen und institutionellen. Die beste technische Lösung bringt nichts, wenn sie nicht gesellschaftlich akzeptiert wird, wenn die Politik ihr einen Riegel vorschiebt oder die Infrastruktur nicht gegeben ist. Es ist nicht so, dass diese Aspekte an den Unis gar nicht gelehrt werden. Aber ich denke, dass es hier noch Luft nach oben gibt. Diese übergeordneten Fähigkeiten sind es, die Ingenieure wirklich benötigen, die aber den Berufszweig gleichzeitig auch so interessant machen.
Wie lassen sich diese vermitteln?
Das Studium muss deutlich interdisziplinärer und der Blick über technologische Aspekte deutlich ausgeweitet werden. Zudem braucht es eine gehörige Portion Pioniergeist, denn für die Transformationsprozesse, in denen wir uns befinden, existieren keine Blaupausen. Es geht aufgrund der Vielschichtigkeit der Herausforderungen darum, Synergien zu suchen, Konflikte zu verhindern oder, falls dies nicht möglich ist, offen zu verhandeln – und vor allem Lösungen zu entwickeln, die eine gewisse Flexibilität besitzen. Stichwort Resilienz: Eine technische Lösung ist dann zeitgemäß, wenn sie in der Lage ist, sich immer wieder an neue Gegebenheiten anzupassen.
Zum Wuppertal Institut
Das Wuppertal Institut versteht sich als führender internationaler Thinktank für eine wirkungs- und anwendungsorientierte Nachhaltigkeitsforschung. Im Fokus der Arbeiten steht die Gestaltung von Transformationsprozessen hin zu einer klimagerechten und ressourcenleichten Welt. Übergeordnetes Ziel der Institutsarbeit ist es, einen Beitrag zur Einhaltung der planetaren Grenzen zu leisten. Dafür stellt das Institut, wie es auf der Homepage heißt, Zukunftswissen bereit, das Ziel-, System- und Transformationswissen bündelt.