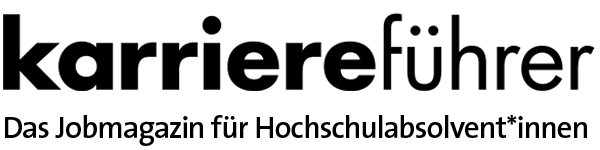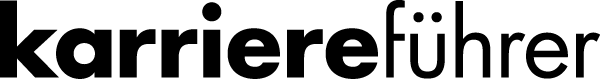Der Finanzmarkt-Experte. Seit Prof. Max Otte bereits im Jahr 2006 die Finanzkrise vorhersagte, gilt der deutsch-amerikanische BWL-Professor als einer der bedeutsamsten Analytiker des Finanzwesens. Im karriereführer-Interview begründet er, warum die Branche mehr Intellekt benötigt und er lieber laute Rockmusik als Golf spielt. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Max Otte (geboren als Matthias Otte am 7. Oktober 1964 in Plettenberg) studierte zunächst BWL, VWL und Politik an der Uni Köln. In Washington und Princeton setzte er seine Studien mit dem Schwerpunkt Finanzwesen fort. Nach Tätigkeiten als Assistant Professor in Boston oder wissenschaftlicher Mitarbeiter an deutschen Hochschulen ist er seit 2001 BWL-Professor an der Hochschule Worms. Als Publizist sorgte Max Otte 2006 mit seinem Buch „Der Crash kommt. Die neue Weltwirtschaftskrise und wie sie sich darauf vorbereiten“ für Aufsehen, in dem er den Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts und die folgende Bankenkrise vorhersagte. 2008 legte Otte mit seinem Institut für Vermögensentwicklung einen ersten eigenen Investmentfonds auf. Seit 2011 besitzt er eine Professur am Institut für Unternehmensführung der Uni Graz. Er ist Börsianer der Jahre 2009, 2010 und 2011. In seiner Freizeit spielt Max Otte leidenschaftlich E-Gitarre – am liebsten Blues-Rock im Stil von ZZ Top.
Herr Prof. Otte, Sie haben bei einem Vortrag im vergangenen Jahr mit Blick auf die Finanzbranche die Begriffe „Krise 2.0“ und „Endspiel“ benutzt. Sollten diese Zustände einen Einsteiger entmutigen – oder die Lust auf den Karrierestart noch erhöhen?
Gute Leute werden immer gebraucht. Hinzu kommt: In heißen Phasen wird generell viel durcheinandergewirbelt. Passiert das, bin ich lieber jung als alt, denn gerade, wenn viel passiert, eröffnen sich spannende und außergewöhnliche Karrierewege. Um diese zu nutzen, muss man jedoch zu den höchstens 20 Prozent der Absolventen gehören, die beweglich sind, sich auf Netzwerken verstehen und Chancen nicht nur erkennen, sondern auch annehmen.
Was ist mit den anderen 80 Prozent?
Die wollen Sicherheit und suchen von Beginn an nach ihr. Und zwar auch dann noch, wenn sie bereits ahnen, dass es diese nicht mehr gibt.
Bereiten die Hochschulen die Absolventen auf die heiße Phase der Finanzbranche vor?
Leider nicht. Es wird den jungen Menschen immer weniger breites Denken, weniger Reflexion nahe gebracht. Stattdessen geht es darum, Fachwissen einzutrichtern, Lehrpläne abzuarbeiten. So sind Wissensfabriken entstanden, in denen die so wichtige Meta-Ebene vollkommen vergessen wird.
Was meinen Sie damit konkret?
Zum einen fehlt die Interdiszplinarität. Zum anderen wird versucht, Dinge, die eigentlich nur qualitativ zu messen sind, quantitativ zu bewerten. Forschung konnte früher bedeuten, dass jemand vier Jahre lang scheinbar nichts tut – und dann eine große Entdeckung macht. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Studierenden müssen produzieren, das Denken wird dadurch abgeschafft. In der Folge ist ein großer Anteil der BWL-Abgänger genormt.
Was raten Sie jungen Menschen, wie kann man in dieser Hinsicht eigenverantwortlich aufrüsten?
Ich empfehle, zwischen Uni und Job-Einstieg oder in einer frühen Phase der Karriere ein Jahr lang mal etwas ganz Anderes zu machen. Das kann zum Beispiel eine intensive lange Reise sein – aber bitte auf eigene Faust und nicht nur im Rahmen eines fachlichen Austauschprogramms, bei dem dann doch wieder alles vorgedacht ist. Es geht darum, selber etwas zu organisieren und eine Aufgabe zu identifizieren. Die Chancen stehen gut, dass sich irgendwann ein Arbeitgeber findet, der diese Erfahrungen honoriert. Denn wer sich mit künstlerischen, sozialen, politischen oder historischen Themen beschäftigt, lernt eine andere Art des Denkens. Diese benötigt man später, wenn man im Beruf in der Finanzwelt nicht nur vorankommen, sondern auch einen Unterschied machen möchte. Einsteiger können auch das Glück haben, im Unternehmen einen Mentor zu treffen, der ihnen dieses Denken beibringt. Aber dass man einem solchen Menschen begegnet, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch in den Unternehmen haben es Menschen, die sich als Unternehmer, Innovatoren und Hinterfrager betrachten und so handeln, nicht leicht.
Forschung konnte früher bedeuten, dass jemand vier Jahre lang scheinbar nichts tut – und dann eine große Entdeckung macht.
Interessant ist dabei, dass Personaler gerne behaupten, genau solche Leute zu suchen.
Na ja, häufig heißt die Devise: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.“ Ja, die Leute sollen unternehmerisch denken. Aber sich an das Unternehmen anpassen sollen sie sich eben auch. Das ist nun wirklich nicht einfach unter einen Hut zu bekommen. Hinzu kommt, dass besonders in der Finanzbranche der Spielraum für eigenes und freies Handeln sehr eng begrenzt ist. Die Unternehmen der Finanzbranche sind in der Bürokratie gefesselt. Das widerspricht der Idee der freien Wirtschaft, nach der ein Unternehmen machen kann, was es will, solange es keine Gesetze bricht. Heute ist es so, dass die Akteure in einem Finanz-Unternehmen persönlich dafür haftbar gemacht werden können, wenn sie ökonomische Entscheidungen getroffen haben, die sich rückblickend als falsch erweisen. In der Folge handeln diese Akteure nicht mehr unternehmerisch, sondern denken die Regularien immer schon mit.
Nun bietet die Finanzbranche Einsteigern einige Optionen. Welcher Bereich ist dabei für welchen Typ geeignet?
Es gibt vier bedeutsame Felder mit tatsächlich sehr verschiedenen Schwerpunkten. Da ist auf der einen Seite das Kreditgeschäft, das derzeit ein wenig an Attraktivität eingebüßt hat, weil hier die Regulierungen die Mitarbeiter besonders einengen. Zweitens das Investment-Management, also Fonds- und Asset-Management – ein spannendes Feld, in dem man auch seine intellektuelle Ader ausleben kann. Drittens das Investment-Banking, das mit dem vorher erwähnten Investment-Management nur wenig zu tun hat. Investment-Banking, das sind die schnellen Deals. Für viele Einsteiger ist das die Königsdisziplin, gefragt sind messerscharfe Analytiker und Draufgänger. Für Menschen, die über viel Fachwissen verfügen und den direkten Umgang mit Kunden schätzen, ist neben dem Kreditgeschäft viertens das Private-Banking ein passender Bereich.
Ihnen liegt als unabhängiger Fondsmanager das Investment-Management besonders am Herzen. Warum kommt es hier eben auch auf intellektuelle Fähigkeiten an?
Die moderne Ökonomie behauptet gerne, die modernen Märkte seien effizient. Das ist grundfalsch. Die Ansicht hält sich dennoch weiter dogmatisch. Wäre sie richtig, könnten Sie sich das Investment-Management sparen. Denn hier geht es schließlich darum, zu entschlüsseln, wo das Verhältnis zwischen Chance und Risiko gut ist – und wo es eher weniger gut ist. Um das herauszufinden, muss ich konträr denken. Ich muss wissen, wo die Märkte eben nicht effizient sind, und was daraus folgt. Sprich: Ich bin immer mindestens einen Schritt weiter, erkenne Widersprüche – und das verlangt nach intellektuellen Fähigkeiten.
Wie wichtig sind in diesem Sinne psychologische Fähigkeiten?
Gerade im Asset-Management ist Psychologie wichtig. Man darf sich aber nie von der Psychologie dominieren lassen. An den Märkten ist die Psychologie nämlich zwar kurzfristig sehr mächtig. Mittel- und langfristig jedoch setzt sich die Mechanik durch, sprich: die tatsächlichen Fakten. Daraus folgt, dass man nicht versuchen sollte, aus dem Bauch heraus psychologische Faktoren zu erraten. Das kann schon deshalb nicht funktionieren, weil die psychologischen Effekte sehr flüchtig ist. Grundlage müssen daher die ökonomischen Realitäten bleiben. Erfolgreich ist, wer sich von der Psychologie frei machen kann. Was wiederum nur geht, wenn man sich hier sehr gut auskennt. Dazu zählt übrigens auch, den Einfluss der eigenen Psyche zu erkennen und aus der Analyse herauszulassen. Damit haben viele junge Asset-Mananger zu Beginn ihrer Laufbahn Probleme – ich übrigens zu Beginn auch.
Sie haben ein lautes Hobby: Sie verfügen über eine große Sammlung elektrischer Gitarren und spielen in einer Rockband. Was gibt es Ihnen, es am Feierabend mal krachen zu lassen?
Andere spielen Golf, ich spiele E-Gitarre. Es gibt ein Buch des Journalisten Moritz von Uslar, „Deutschboden“, in dem er eine drei Monate lange Auszeit in der Provinz von Brandenburg beschreibt. Darin beschreibt er den Besuch bei einer Band und berichtet dabei von der Urgewalt, die einen trifft, wenn vier Menschen an ihren Rockinstrumenten loslegen. Hier entsteht eine unglaubliche Energie – und ich gebe von Uslar Recht, es handelt sich um eine Ur-Erfahrung. Ich kann nur jeden bedauern, der das noch nicht erleben durfte.
Weil er lieber Golf spielen geht.
Wenn es um Job-Talk geht, ist Golf vielleicht besser. Aber mit der kathartischen Erfahrung einer Bandprobe kann es diese Beschäftigung in keiner Weise aufnehmen.
Nachdem Sie 2006 als einer der ersten die Finanzkrise vorausgesagt haben, gelten Sie als eine Art Orakel. Verändert der EU-Austritt Großbritanniens die Finanzbranche?
Ob der Brexit kommt oder mit aller Konsequenz umgesetzt wird, sei dahingestellt. Das britische Volk wollte es, aber die Eliten wollen etwas anderes. Sollte er aber weitgehend umgesetzt werden, würde sich Großbritannien selbst schaden. Gleichzeitig wäre es eine Riesenchance für den Finanzplatz Frankfurt.